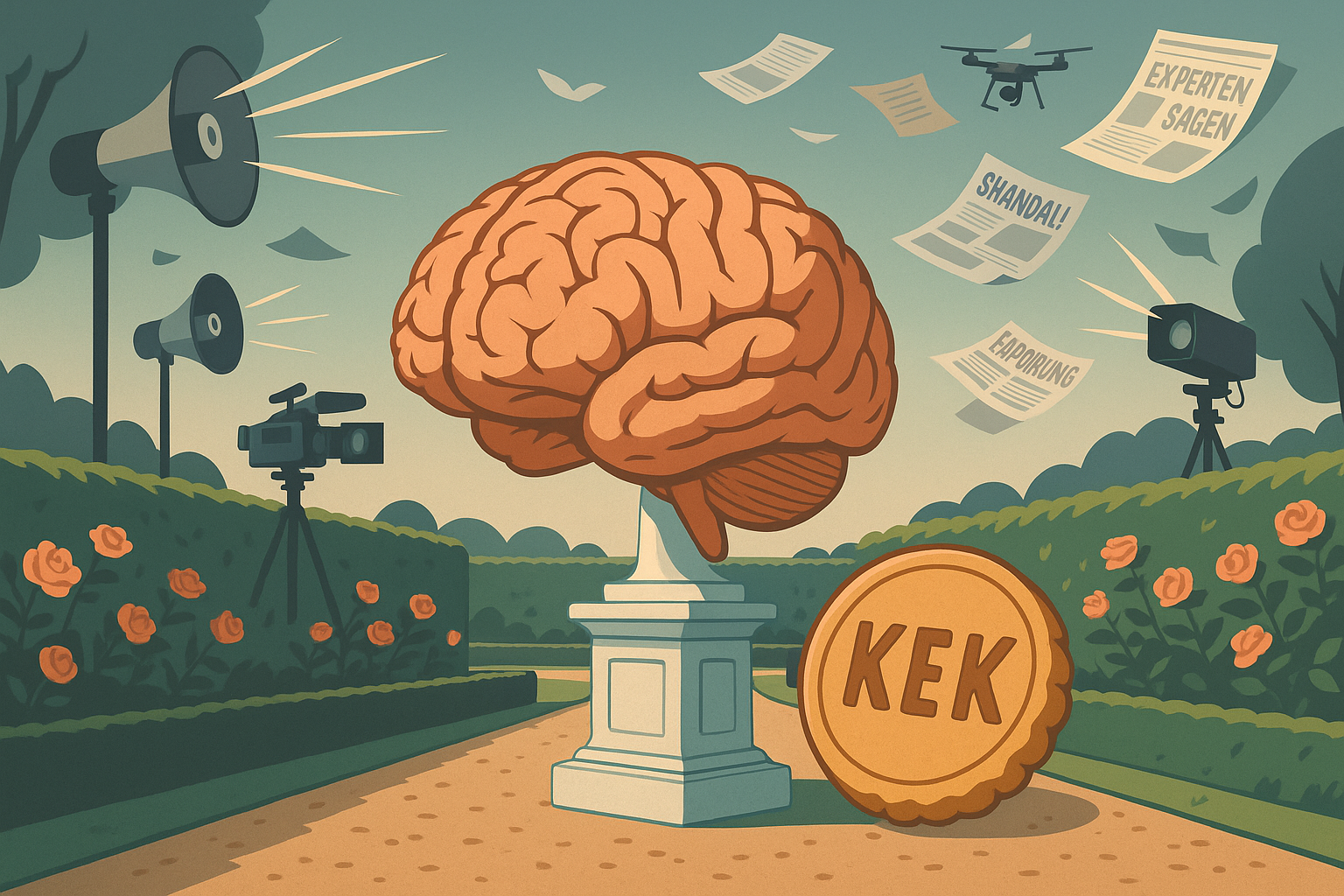von Dr. Christoph v. Gamm, 5. September 2025
Irgendwann kann es jeden treffen: Die Bestandsmedien werden auf Sie aufmerksam und versuchen Sie medial kaltzustellen. Es wird ein „Hitpiece“ gegen Sie vorbereitet.
Ein sogenanntes „Hitpiece“ ist ein Medienbeitrag, der weniger auf sachliche Aufklärung abzielt, sondern primär die Rufschädigung einer Person oder Organisation bezweckt. Dies kann jeden treffen, insbesondere aber politische Gegner linker Parteien.
Charakteristisch sind dabei Techniken wie das Weglassen von Kontext, die Verwendung isolierter Zitate und das Erzeugen von Schuld durch Assoziationen. Die Taktik folgt oft dem Prinzip, eine Person gezielt mit Schmutz zu bewerfen, in der Hoffnung, dass „irgendwas schon hängen bleibt“ und daß im Zuge des „Hitpieces“ und der anfolgenden Kommunikation sich die Person, die zum Gegner auserkoren wurde, von selbst noch mehr „medial belastet“.
Dieser Leitfaden bietet eine praxiserprobte Methode, um in einer solchen Situation einen kühlen Kopf zu bewahren und die Deutungshoheit zu behalten.
Dies ist keine Rechtsberatung, sondern eine Kommunikationsberatung. Für rechtliche Schritte empfehlen wir den Kontakt eines Rechtsanwalts Ihres Vertrauens.
Phase 1: Früherkennung und präventive Vorbereitung
Noch bevor eine direkte Konfrontation stattfindet, gibt es oft leise Signale. Wenn Sie diese bemerken, ist es Zeit, mit den grundlegenden Vorbereitungen zu beginnen.
Frühe Warnsignale erkennen
- LinkedIn: Eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Profilaufrufen durch Personen mit Berufsbezeichnungen wie „Redakteur“, „Freier Journalist“, „Researcher“ oder von Produktionsfirmen. Oftmals gehen damit Kaltanfragen von Praktikanten ein, die „nur kurz sprechen“ wollen.
- Ihre Aktion: Erstellen Sie Screenshots von Profilbesuchern und legen Sie eine Liste mit Namen und Firmen an. Beantworten Sie alle Anfragen konsequent nur schriftlich.
- X (Twitter) / Soziale Medien: Sie bemerken neue Follower oder werden zu Listen mit Namen wie „Investigatives“ oder „Media Monitoring“ hinzugefügt. Unter alten Beiträgen tauchen von oft neuen Accounts Fragen nach Kontext auf („Können Sie bestätigen, dass…?“).
- Ihre Aktion: Sichern Sie den Kontext der Beiträge durch Permalinks und Screenshots. Antworten Sie ausschließlich sachlich und vermeiden Sie neue Angriffsflächen.
- Website / Blog: Sie stellen in Ihren Analytics-Daten Zugriffsspitzen aus Netzwerken von Medienhäusern fest. Insbesondere das Impressum, ältere Beiträge oder Downloads werden vermehrt aufgerufen.
- Ihre Aktion: Exportieren Sie Ihre Server- und Analytics-Logs und überprüfen Sie Ihr Impressum. Beginnen Sie mit der Vorbereitung einer nicht-öffentlichen Dokumentationsseite.
Ihre präventive Vorbereitung
Sobald Sie erste Signale erkennen, sollten Sie folgende Maßnahmen ergreifen:
- Beleg-Ordner anlegen: Strukturieren Sie einen Ordner für relevante Dokumente, z.B. für Vita, Inhalte mit Kontext, die gesamte Redaktionskommunikation, eventuelle Korrekturen und eine Chronologie der Ereignisse.
- Umfeld-Briefing vorbereiten: Verfassen Sie einen Kurztext für Ihr berufliches und privates Umfeld mit der Bitte, bei Anfragen keine Aussagen zu tätigen, sondern direkt auf Ihre zentrale E-Mail-Adresse zu verweisen.
- Standard-Antwort formulieren: Erstellen Sie eine E-Mail-Vorlage, in der Sie um die Zusendung konkreter Tatsachenbehauptungen, einen Fragenkatalog sowie Sendeformat und -termin bitten. Kündigen Sie eine schriftliche Antwort an und machen Sie Interviews von einer eigenen Aufzeichnung abhängig.
- Privatsphäre prüfen: Deaktivieren Sie Standort-Tags, bereinigen Sie alte Profile und überprüfen Sie die Zugriffsberechtigungen auf alte Beiträge.
Phase 2: Die Lage spitzt sich zu
Die Anfragen werden nun konkreter und direkter. Die Journalisten weiten ihre Recherche aus und konfrontieren Sie mit ersten Vorwürfen.
Mittlere bis späte Signale
- Anfragen bei Dritten: Ihr Arbeitgeber, Kunden, ehemalige Partner oder Vereinskollegen werden kontaktiert mit der Information, man recherchiere zu Ihrer Person.
- Ihre Aktion: Verteilen Sie Ihr vorbereitetes 1-seitiges Briefing an Ihr Umfeld mit der klaren Anweisung: nichts mündlich kommentieren, alle Anfragen an Sie weiterleiten.
- Vage Fragenkataloge: Sie erhalten per E-Mail vage formulierte Vorwürfe mit einer knappen Frist (z.B. „bis morgen 12:00 Uhr“). Typische Formulierungen sind „umstritten“, „es gibt Vorwürfe“, „Experten warnen“ oder vage Zeiträume wie „in den letzten Jahren“.
- Ihre Aktion: Bestehen Sie auf einer Konkretisierung der angeblichen Tatsachenbehauptungen und fragen Sie nach Belegen. Setzen Sie eine realistische Frist für Ihre schriftliche Stellungnahme.
- Überraschungsbesuche („Doorstepping“): Ein Kamerateam erscheint unangekündigt vor Ihrem Büro oder Zuhause für „nur eine kurze Frage“.
- Ihre Aktion: Bleiben Sie ruhig. Notieren Sie sich Ort, Zeit sowie die Namen der Anwesenden und deren Redaktion. Geben Sie unter keinen Umständen ein Spontanstatement ab und bieten Sie stattdessen eine schriftliche Stellungnahme an.
Phase 3: Die direkte Konfrontation und Ihre Antwort
Jetzt geht es darum, die Kommunikation zu steuern und strukturiert zu antworten. Ihr Ziel ist es, vom reagierenden Objekt zum handelnden Akteur zu werden.
- Definieren Sie das Spielfeld: Führen Sie die gesamte Kommunikation mit der Redaktion schriftlich. Bieten Sie eine fristgerechte schriftliche Stellungnahme an und stimmen Sie Interviews nur unter der Bedingung einer eigenen, vollständigen Aufzeichnung zu. Sagen Sie nichts „off the record“. ES GIBT KEIN OFF THE RECORD!
- Sichern Sie Beweise und Fakten: Legen Sie eine detaillierte Chronologie der Ereignisse an und sichern Sie alle relevanten E-Mails, Nachrichten und Dokumente. Erstellen Sie ein einseitiges Factsheet, das Ihre Kernaussagen mit den wichtigsten Belegen zusammenfasst.
- Strukturieren Sie Ihre Antwort (Die 4 Bausteine): Eine effektive Stellungnahme ist kurz, sachlich und zitierfähig.
- These: Stellen Sie klar, was an der Behauptung falsch oder verkürzt dargestellt ist.
- Beleg: Führen Sie an, welche Dokumente oder Quellen Ihre Position beweisen (verlinken oder anhängen).
- Kontext: Erklären Sie, welcher entscheidende Hintergrund in der Anfrage fehlt.
- Schluss: Formulieren Sie klar Ihre Erwartung an eine faire und korrekte Wiedergabe.
- Bereiten Sie eigene Kanäle vor („Prebunking“): Erstellen Sie eine nüchterne Erklärung und eine Dokumentationsseite mit den Fakten für Ihre eigene Website oder Ihren Newsletter. So können Sie dem Publikum bei Bedarf einen Referenzrahmen bieten, bevor der Beitrag erscheint.
Phase 4: Nach der Veröffentlichung
Ist der Beitrag gesendet oder publiziert, beginnt die Phase der Analyse und der dosierten Reaktion.
- Prüfen und dokumentieren: Vergleichen Sie den Beitrag systematisch mit Ihren Belegen. Markieren Sie falsche Tatsachenbehauptungen, sinnentstellende Schnitte oder die Verweigerung Ihrer Erwiderung.
- Proportional reagieren: Eine überzogene Reaktion stärkt oft nur den ursprünglichen Frame des Beitrags. Handeln Sie angemessen:
- Ein ruhiger Transparenz-Thread in den sozialen Medien kann ausreichen.
- Bei falschen Tatsachenbehauptungen können Sie eine
Gegendarstellung verlangen. - Bei Verstößen gegen journalistische Grundsätze (z.B. mangelnde Objektivität) ist eine Programmbeschwerde (beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk) möglich.
- In schwerwiegenden Fällen sollten Sie zeitnah rechtliche Schritte wie eine
Unterlassungs- oder Berichtigungsklage prüfen lassen. Bitte besprechen Sie dies mit einem guten Rechtsanwalt.
Zusammenfassung: Grundregeln und häufige Fehler
- Zu vermeidende Fehler:
- Lassen Sie sich nicht auf Nebenkriegsschauplätze ablenken.
- Veröffentlichen Sie keine emotionsgeladenen Reaktionen, bevor Sie den Beitrag vollständig gesichtet haben.
- Halten Sie Ihre Statements kurz (300-600 Wörter); alles andere wird ohnehin gekürzt.
- Vermeiden Sie Ironie und Sarkasmus; dies wird fast immer gegen Sie verwendet.
- Ihr Notfallplan in Kurzform:
Belege sichern → Spielfeld definieren → knapp und belegbar antworten → eigene Kanäle vorbereiten → nach der Ausstrahlung prüfen und gezielt handeln.
Bleiben Sie ruhig. Langfristig siegt Substanz über tendenziösen Schnitt.
Für Unterstützung und diskrete Hilfe – gegen Honorar – können Sie uns gerne kontaktieren.