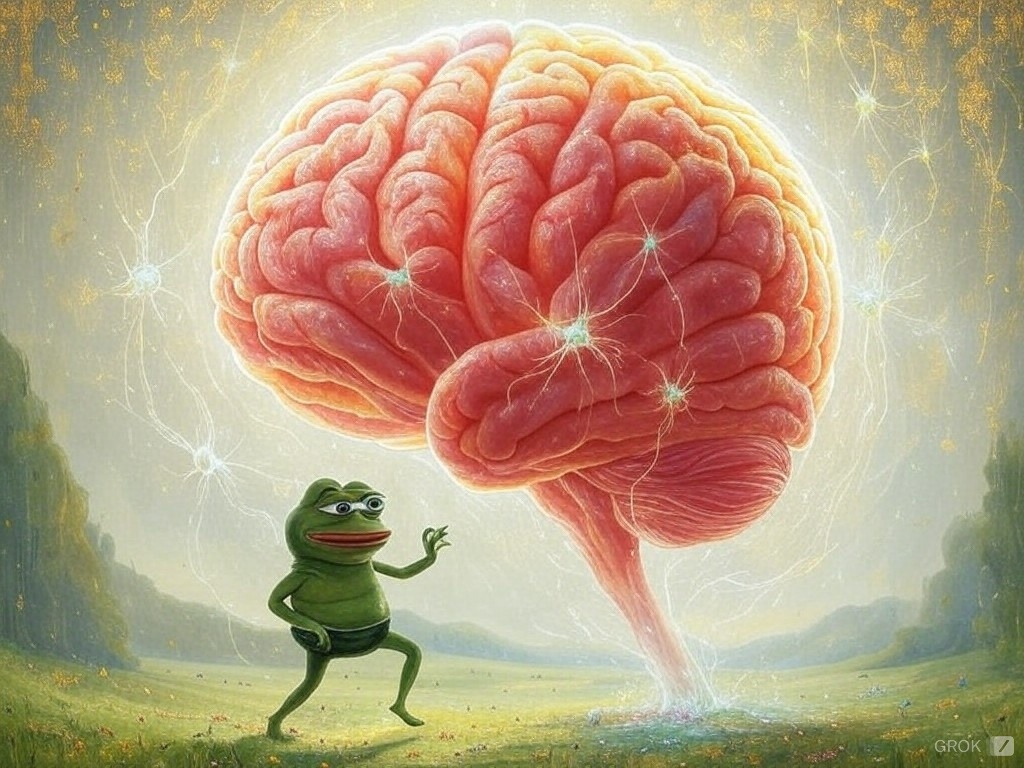Macht, Netzwerk und Groteske: Eine kulturkritische Analyse von Mel Brooks‘ „The Hitler Rap“
Christoph von Gamm, 4. September 2025
To Be or Not To Be: Mel Brooks – Hitler Rap (1983)
Download als PDF:
Zusammenfassung des Inhalts
Zusammenfassung des Inhalts
Das Dokument analysiert Mel Brooks‘ Musikvideo „The Hitler Rap“ (1983) aus kulturkritischer Sicht. Insbesondere in Deutschland gab es sowohl während des Dritten Reichs als auch nach dem Dritten Reich ein großes, strafbewehrtes Tabu:
„DU DARFST DICH NICHT ÜBER DEN FÜHRER LUSTIG MACHEN!“ Und in gewisser Hinsicht gilt dieses Diktum in der deutschen Justiz immer noch. Diesmal gelten jedoch die Maßnahmen nach §130 StGB (Volksverhetzung und Verharmlosung), §86a StGB (verfassungswidrige Kennzeichen).
Mel Brooks (geb. 1928 als Melvin James Kaminsky in Brooklyn) hingegen darf es. Und er nutzte es mit Wonne. Und das perfekt. Hier eine Ode an den großen Künstler Mel.
Die zentrale These ist, daß „The Hitler Rap“ als erfolgreicher Foucault’scher Gegendiskurs fungiert, der das nationalsozialistische „Wahrheitsregime“ durch groteske Parodie untergräbt. Gleichzeitig zeigt eine Latour’sche Analyse des Videos als nicht-menschlicher Akteur in einem globalen Mediennetzwerk die Risiken der „Übersetzung“ und Dekontextualisierung auf. Es wird argumentiert, daß Mel Brooks‘ Identität als jüdisch-amerikanischer Komiker und seine explizite Absicht, Hitler seine „posthume Macht zu rauben“, als entscheidender stabilisierender Faktor wirken, der die entmystifizierende Kraft des Werks überwiegen lässt.
Hauptpunkte der Analyse:
- Foucault’sche Diskursanalyse:
- Das Video attackiert die nationalsozialistische Ästhetik, indem es Hitlers Bild durch den „grotesken Körper“ eines tanzenden, rappenden jüdischen Mannes ersetzt.
- Die Liedtexte demontieren systematisch NS-Mythen, z.B. die Legitimität der „Machtergreifung“ oder die Überlegenheit der „arischen Rasse“.
- Die letzte Zeile über die Flucht nach Argentinien aktiviert „unterworfenes Wissen“ über die „Rattenlinien“ und stellt die bereinigte Nachkriegserzählung in Frage, und das bereits im Jahr 1983!
- Brooks’ Humor wird als strategische Form des Widerstands verstanden, der Macht/Wissen-Strukturen von innen heraus untergräbt.
- Latour’sche Netzwerkanalyse (Akteur-Netzwerk-Theorie – ANT):
- Das Video wird als „Aktant“ betrachtet, der als Teil eines heterogenen Netzwerks (mit Akteuren wie Mel Brooks, dem Rap-Genre, MTV und der Nazi-Uniform) Handlungsfähigkeit besitzt.
- Der Prozess der „Übersetzung“ transformiert den historischen Schrecken in ein Pop-Produkt, was Vereinfachung und Ästhetisierung mit sich bringt und das Risiko der Trivialisierung birgt.
- Trotz dieses Risikos wird Brooks‘ jüdische Identität und seine erklärten Absichten als stabilisierender Anker im Netzwerk gesehen, der verhindert, daß das Video in reine, bedeutungslose Ästhetik kollabiert.
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, daß „The Hitler Rap“ ein geniales Werk ist, das die Mechanismen des populären Diskurses erfolgreich nutzt, um einen politischen Schrecken anzugreifen, und zeigt, daß effektiver Widerstand manchmal darin besteht, das System zu kapern und für subversive Zwecke zu nutzen.
Einleitung: Der tanzende Diktator als diskursive Provokation
Gegenstand, Leitfragen, These
Das Musikvideo „To Be or Not To Be (The Hitler Rap)“ entstand 1983 im Umfeld des Film‑Remakes To Be or Not to Be (1983). Mel Brooks tritt in NS‑Uniform als Hitler‑Figur auf, erzählt Hitlers „Lebensgeschichte“ in Rap‑Form und mischt Parodie, Camp, Musicalgesten und popkulturelle Requisiten des frühen MTV‑Zeitalters. Der Track war international erfolgreich (u. a. UK‑Charts) und löste besonders in Deutschland Diskussionen aus1-3, 66.
Leitfragen: Entmystifiziert das Video den Nationalsozialismus, indem es ihn ins Lächerliche zieht? Oder ästhetisiert die schmissige Pop‑Form NS‑Bildwelten so, daß sie „anschlussfähig“ wirken? Wie wirkt die Schlusszeile „One way ticket to Argentina“ auf globale Rezeption und Erinnerungspolitik? Die Analyse verbindet Michel Foucaults Diskursanalyse (Ausschluss-/Zulassungsregeln, Autorfunktion) mit Bruno Latours Akteur‑Netzwerk‑Theorie (Mediation, Übersetzung, Iconoclash).
These: Brooks erzeugt eine kontrollierte Regelverletzung eines hochsensiblen Diskurses und bricht die Aura des „Erhabenen“ komisch. Als Mediator in einem umkämpften Netzwerk (Labels, TV‑Gatekeeping, Publikum, Charts, spätere Online‑Zirkulation) stabilisiert das Video mehrheitlich eine entmystifizierende Lesart—unter dem strukturellen Risiko des Iconoclash: daß dieselben Zeichen je nach Kontext erneut affektiv aufgeladen werden können 58-63.
Kontext: Song, Video, Film, Rezeption
Werkdaten & Inhalt. Der Song erschien 1983 bei Island Records (Prod./Co‑Autor u. a. Pete Wingfield); das Video inszeniert Brooks als rappenden „Hitler“, der Stationen von Aufstieg und Untergang parodistisch durchläuft (Call‑and‑Response, Tanz, Refrain‑Hooks). Die Extended‑Fassung endet mit „One way ticket to Argentina“—eine Verdichtung populären Wissens um NS‑Täterexile in Südamerika 1,3, 63-64.
Im Jahr 1983 erschien ein kulturelles Artefakt, das bis heute durch seine paradoxe Natur provoziert: das Musikvideo „To Be or Not To Be (The Hitler Rap)“. Darin tritt der jüdisch-amerikanische Komiker Mel Brooks, gekleidet in eine Adolf-Hitler-Uniform, als Rapper auf und erzählt in einem unbekümmerten, autobiografisch anmutenden Ton die Geschichte des Aufstiegs und Falls des Dritten Reiches.1 Die unmittelbare Schockwirkung dieser Inszenierung, gepaart mit ihrem überraschenden internationalen Erfolg – der Song erreichte hohe Chartplatzierungen in mehreren Ländern, darunter Platz 1 in Norwegen 1 –, bildet den Ausgangspunkt für diese kulturkritische Untersuchung.
Rezeption international: Der Titel erreichte u. a. in Großbritannien die Top 20, in Skandinavien und Australien ebenfalls hohe Platzierungen—ein Indiz, daß die Lesart „Satire gegen Hitler“ im internationalen Popumfeld überwog 55-56.
Rezeption in Deutschland: Zeitgenössische Berichte dokumentieren eine vorsichtige bis ablehnende TV‑ und Radio‑Praxis (z. B. Rücknahmen aus Musiksendungen), zugleich aber deutliche Chart‑Resonanz—ein Muster kontroverser Popularität 66.
Das Video wirft eine zentrale analytische Frage auf, die den Kern dieser Arbeit bildet: Gelingt es diesem Akt der satirischen Aneignung, eine totalitäre Ideologie zu entmystifizieren und ins Lächerliche zu ziehen und damit, wie Brooks es selbst formulierte, „Hitler seine posthume Macht zu rauben“?4 Oder besteht im Gegenteil die Gefahr, daß die Verwendung eines eingängigen Pop-Formats und einer polierten visuellen Ästhetik den historischen Schrecken trivialisiert, faschistische Symbole von ihrer historischen Last entkoppelt und den Nationalsozialismus als Unterhaltungsprodukt „schick“ oder konsumierbar macht?7
Brooks’ Intention. In Interviews begründet Brooks sein Programm: Mit Comedy könne man Hitler „postum die Macht rauben“—eine dezidierte Strategie der Entzauberung durch Spott 57.
Die zentrale These dieses Berichts lautet, daß „The Hitler Rap“ in erster Linie als ein wirkungsvoller Foucault’scher Gegendiskurs fungiert, der das nationalsozialistische „Wahrheitsregime“ durch groteske Parodie erfolgreich untergräbt. Gleichzeitig offenbart eine Latour’sche Analyse des Videos als nicht-menschlicher Akteur innerhalb eines globalen Mediennetzwerks die inhärenten und unvermeidlichen Risiken der „Übersetzung“ und Dekontextualisierung, die eine solche Strategie begleiten. Es wird argumentiert, daß die spezifische Identität von Mel Brooks als entscheidender stabilisierender Faktor in diesem Netzwerk fungiert und letztlich sicherstellt, daß die entmystifizierende Kraft des Werks sein Potenzial zur Trivialisierung überwiegt. Die theoretischen Rahmenwerke von Michel Foucault und Bruno Latour dienen dabei als primäre analytische Linsen.
Teil I: Theoretische Fundamente der Analyse
1.1 Foucault: Macht/Wissen, Diskurs und der satirische Gegendiskurs
Macht/Wissen (Le savoir-pouvoir)
Michel Foucault revolutionierte das Verständnis von Macht, indem er sie nicht als eine repressive, von oben nach unten wirkende Kraft beschrieb, sondern als ein produktives, allgegenwärtiges Netzwerk, das Realität, Wissensbereiche und Subjekte selbst erschafft.9 Macht ist nicht etwas, das man besitzt, sondern etwas, das ausgeübt wird, und sie durchdringt alle gesellschaftlichen Ebenen auf „kapillare“ Weise.9 In Foucaults Neologismus „Macht/Wissen“ sind beide Konzepte untrennbar miteinander verbunden: Macht produziert Wissen, das wiederum die Machtstrukturen verstärkt und legitimiert.12 Das nationalsozialistische Regime lieferte hierfür ein extremes Beispiel, indem es durch pseudowissenschaftliche Rassentheorien ein „Wissen“ produzierte, das seine mörderische Macht legitimierte.
Diskurs und Wahrheitsregime
Foucault definiert Diskurs als ein historisch kontingentes System von Aussagen, Praktiken und Institutionen, das festlegt, was über ein bestimmtes Thema gesagt, gedacht und gewusst werden kann. Ein solcher Diskurs erschafft ein „Wahrheitsregime“.10 Der Nationalsozialismus war ein solcher allumfassender Diskurs, der durch Propaganda, eine spezifische Ästhetik, Rituale und institutionelle Kontrolle seine eigene Realität und seine eigenen „Wahrheiten“ produzierte, die das Sag- und Denkbare bestimmten.
Widerstand und Gegendiskurs
Eine zentrale These Foucaults lautet: „Wo Macht ist, ist auch Widerstand“.11 Widerstand ist der Macht nicht äußerlich, sondern existiert innerhalb des Machtgefüges und nutzt dessen eigene Mechanismen. Satire kann als eine wesentliche Form des Gegendiskurses verstanden werden: eine Sprechweise, die die Sprache, Symbole und Logik eines dominanten Diskurses aufgreift, um ihn von innen heraus zu untergraben, zu entlarven und lächerlich zu machen. Ein solcher Gegendiskurs macht den dominanten Diskurs „zerbrechlich und ermöglicht es, ihn zu vereiteln“.10 Mel Brooks‘ Komik lässt sich exakt als eine solche strategische Form des Widerstands begreifen.
1.2 Latour: Die Akteur-Netzwerk-Theorie und die Handlungsfähigkeit der Medien
Akteure/Aktanten und generalisierte Symmetrie
Die Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) von Bruno Latour geht von „Aktanten“ aus – jede Entität, ob menschlich oder nicht-menschlich, die als Quelle einer Handlung betrachtet werden kann.18 Das Prinzip der „generalisierten Symmetrie“ verlangt vom Analytiker, menschlichen Akteuren nicht von vornherein einen privilegierten Status gegenüber nicht-menschlichen Akteuren (wie einem Musikvideo, einer Technologie oder einer Ideologie) einzuräumen.20
Netzwerke und Übersetzung
Laut ANT wird die Realität durch sich ständig verändernde Netzwerke (oder „Assemblagen“) dieser heterogenen Aktanten konstituiert.18 Der Schlüsselprozess innerhalb dieser Netzwerke ist die „Übersetzung“ (oder „Transport mit Deformation“). Dabei wird eine Idee, ein Objekt oder ein Akteur in ein Netzwerk eingeschrieben und dabei unweigerlich transformiert.20 Dieses Konzept ist entscheidend, um zu verstehen, wie die historische Figur Hitler in das popkulturelle Artefakt „The Hitler Rap“ transformiert wird.
Die Handlungsfähigkeit (Agency) von Nicht-Menschen
Der für diese Analyse nützlichste Aspekt der ANT ist die Zuschreibung von Handlungsfähigkeit an nicht-menschliche Akteure. Ein Musikvideo, das Genre Rap oder eine Vertriebsplattform wie MTV sind keine passiven Kanäle, sondern aktive Mediatoren, die bestimmte Handlungen und Bedeutungen „autorisieren, erlauben, ermutigen, nahelegen, beeinflussen oder verbieten“.22 Das Video zum „Hitler Rap“ wird somit nicht nur als etwas analysiert, das Brooks gemacht hat, sondern als ein Aktant, der in der Welt Dinge getan hat.
Die Kombination beider Theorien ermöglicht eine dialektische Analyse. Foucault liefert die Werkzeuge, um die Intention und den Inhalt des Gegendiskurses zu analysieren – was Brooks dem nationalsozialistischen Wahrheitsregime entgegensetzen will. Latour hingegen ermöglicht die Analyse der materiellen Reise und der unbeabsichtigten Konsequenzen des kulturellen Artefakts selbst, während es sich durch Netzwerke bewegt, übersetzt wird und seine eigene Handlungsfähigkeit entfaltet. Dieser duale Ansatz führt zu einer nuancierteren Antwort auf die Kernfrage, ob das Video entmystifiziert oder verharmlost. Er zeigt, daß das Video ein erfolgreicher Gegendiskurs ist, dessen mediale Form als Pop-Produkt untrennbar das Risiko der Trivialisierung in sich birgt.
“Nicht jeder darf über alles sprechen”
Foucault versteht Diskurse als durch Verbots‑ und Zulassungsregime regulierte Formationen. „Nicht jeder darf über alles sprechen“: Themen wie Sexualität oder Politik unterliegen Ritualen, Institutionen und Autorisierungen. Die Autorfunktion markiert eine Position, die Aussagen besondere Legitimität verleiht. Für Brooks bedeutet das: Seine Position als jüdischer Satiriker verschiebt die Schwelle des Sagbaren und fungiert als Schutzschirm gegen Apologie‑Missdeutungen—ohne sie völlig auszuschließen 58-59.
Latour: Akteur-Netzwerk, Mediation, Iconoclash
Latour schlägt vor, soziale Tatsachen als Netzwerke heterogener Akteure/Aktanten zu rekonstruieren—Menschen, Institutionen, Dinge und Medien. Artefakte sind Mediatoren: Sie verändern Bedeutungen (Übersetzung), statt sie neutral zu transportieren. „Iconoclash“ bezeichnet Bildkämpfe, in denen unklar bleibt, ob ein Bildakt entzaubert oder erneut fasziniert—eine Passung zur NS‑Parodie im Popformat 60,61.
Teil II: Die Genealogie der Nazi-Satire bei Mel Brooks
Regelverletzung als kontrollierter Tabubruch
Die NS‑Vergangenheit ist (insbesondere in Deutschland) ein Hochrisikodiskurs. Brooks unterläuft den Ernst‑Code durch Rap‑Parodie, Tanz und Klamauk. Redaktionsentscheidungen, das Video nicht zu senden oder zurückzuziehen, illustrieren Foucaults Ausschlussverfahren: Institutionelle Gatekeeper begrenzen Zirkulation nicht primär nach Inhaltswahrheit, sondern nach Form und Sprecherposition. Gleichwohl zeigen Chart‑Erfolge, daß Kontrolle kontingent bleibt.56
2.1 „Die einzige Waffe, die ich habe, ist die Komödie“: Brooks‘ subversive Philosophie
Mel Brooks‘ satirische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ist kein einmaliger Ausrutscher, sondern das Kernstück eines lebenslangen künstlerischen Projekts. In zahlreichen Interviews hat er seine Motivation explizit dargelegt: Er will den Spott als Waffe einsetzen, um das mythische, übermenschliche Bild Hitlers zu demontieren und ihn auf eine lächerliche, erbärmliche Figur zu reduzieren.4 Dies beschreibt er als einen Akt der „umgekehrten Machtergreifung“ eines Juden über den größten Feind seines Volkes.4 Indem er das Publikum über Hitler lachen lässt, entzieht er der Figur die „heilige Ernsthaftigkeit“, die sie wie einen Schutzschild umgab.4
2.2 Der jüdische Außenseiter als privilegierter Sprecher
Die Identität von Mel Brooks als jüdischer Amerikaner (geboren als Melvin Kaminsky), der als Soldat im Zweiten Weltkrieg diente, ist für die Rezeption und Legitimität seiner Arbeit von entscheidender Bedeutung.26 Sein Humor wurzelt tief in der jüdischen Außenseitererfahrung von Verfolgung und Überleben.26 Diese Identität verleiht ihm eine einzigartige Autorität, dieses heikle Thema zu behandeln – eine Position, die einem nicht-jüdischen Künstler wie Roberto Benigni, den Brooks für seinen Film
Das Leben ist schön kritisierte, verwehrt bliebe.4 Seine jüdische Herkunft fungiert als Schutzschild gegen den Vorwurf reiner Geschmacklosigkeit und rahmt sein Werk als „Galgenhumor“, der vom Opfer und nicht vom Henker erzählt wird.31
2.3 Von „Springtime for Hitler“ zu „To Be or Not To Be“
„The Hitler Rap“ steht in einer direkten Traditionslinie, die mit dem kontroversen Musical-Stück „Springtime for Hitler“ in seinem Film Frühling für Hitler (The Producers) von 1967 beginnt.33 Das Lied zitiert sogar direkt die Zeile „Don’t be stupid, be a smarty. Come and join the Nazi Party“ und stellt so eine explizite Verbindung zwischen den Werken her.1 Der Rap selbst entstand im Kontext von Brooks‘ Remake des Ernst-Lubitsch-Klassikers Sein oder Nichtsein (To Be or Not to Be) von 1983. Während Lubitschs Original von 1942, das seinerzeit ebenfalls als kontrovers galt, den Nationalsozialismus mit einem subtilen, satirischen „Skalpell“ sezierte, verwendet Brooks einen komödiantischen „Vorschlaghammer“.7 Im Gegensatz zum Original stellt Brooks‘ Version die Verfolgung von Juden und Homosexuellen explizit in den Vordergrund und wird so zu einem direkteren und konfrontativeren diskursiven Akt.37
Brooks‘ gesamtes Schaffen zum Thema Nationalsozialismus kann als eine Foucault’sche „Genealogie“ verstanden werden. Er erzählt nicht nur Witze, sondern vollzieht eine historische Kritik durch die Mittel der Farce. Die genealogische Methode Foucaults zielt darauf ab, zu zeigen, daß das, was notwendig und absolut erscheint, in Wahrheit historisch kontingent und aus oft unrühmlichen Ursprüngen entstanden ist.9 Brooks tut etwas Ähnliches: Er nimmt die Figur Hitler, die vom NS-Diskurs als welthistorische, quasi-göttliche Gestalt inszeniert wurde, und führt sie auf einen erbärmlichen, absurden Ursprung zurück. In Frühling für Hitler wird der Diktator zu einer hippiesken Figur in einem geschmacklosen Musical 33; im „Hitler Rap“ wird sein welthistorisches Projekt auf eine Reihe von Reimen über das Veranstalten einer „Nazi-Party“ reduziert.31 Dieser Prozess entzieht der Figur ihre mythische Aura und entlarvt den banalen, egozentrischen und letztlich lächerlichen Kern hinter der Fassade des Schreckens.
Teil III: Dekonstruktion des „Hitler Rap“ – Eine doppelte Analyse
3.1 Foucauldianische Diskursanalyse: Text, Körper, Wissen
Der groteske Körper des Führers
Die visuelle Rhetorik des Videos stellt einen direkten Angriff auf die nationalsozialistische Ästhetik dar. Der NS-Diskurs konstruierte sorgfältig das Bild Hitlers als machtvollen Redner und Verkörperung einer disziplinierten, arischen Nation. Brooks ersetzt dieses Bild durch den grotesken Körper: ein kleiner, jüdischer Mann in Hitler-Uniform, der eine historisch afroamerikanische Kunstform (Rap) performt, unbeholfen tanzt und dabei eine karikaturistische „schwarze Stimme“ verwendet.3 Dieser Akt der körperlichen und kulturellen Überschreitung zertrümmert das kontrollierte Bild, entlarvt es als Inszenierung und macht es lächerlich.8 Dies steht in einer langen satirischen Tradition, die das Groteske nutzt, um den Anspruch des Totalitarismus auf Ordnung und Reinheit zu untergraben.40
Untergrabung des „Wahrheitsregimes“ durch den Text
Eine genaue Analyse der Liedtexte zeigt, wie sie systematisch die zentralen Mythen der NS-Propaganda demontieren und ritualisiert Tabus verletzten.67 Die nachfolgende Tabelle illustriert diesen Prozess.
| Lyrik aus „The Hitler Rap“ | Ziel des NS-Diskurses/Mythos | Foucaultscher gegendiskursiver Effekt |
| „We had an election. Well – kinda, sorta.“ 3 | Der Mythos der legalen und vom Volk getragenen „Machtergreifung“. | Untergräbt den Anspruch auf Legitimität und entlarvt die Machtergreifung als halblegalen Schwindel, reduziert auf eine beiläufige, fast verlegene Bemerkung. |
| „skinny little Goebbels and Goering mister fat.“ 31 | Der Mythos des arischen Übermenschen und der rassischen Überlegenheit. | Macht die Führungsriege lächerlich, indem ihre physischen Unzulänglichkeiten betont werden, was im direkten Widerspruch zur propagierten arischen Idealfigur steht. |
| „Don’t be stupid; be a smarty / come on and join the nazi party“ 31 | Die Darstellung der NSDAP als elitäre Bewegung mit einer tiefen ideologischen Mission. | Trivialisiert die Parteimitgliedschaft zu einer simplen, fast kindischen Entscheidung und parodiert die verführerische Einfachheit totalitärer Propaganda. |
| „I was on a roll I couldn’t lose / then came D-day the birth of the blues.“ 31 | Die Erzählung vom unausweichlichen Endsieg und der Unbesiegbarkeit der Wehrmacht. | Rahmt die militärische Niederlage in der Sprache des amerikanischen Showbusiness und Blues, was den welthistorischen Anspruch entwertet und die Niederlage als persönliches Pech darstellt. |
Das „Ticket nach Argentinien“ als unterworfenes Wissen
Die kritischste und subversivste Zeile des Liedes ist die letzte: „Auf wiedersehn, good to’ve seen ya. I got a one way ticket to Argentina“.3 Dies ist weit mehr als nur ein Witz über Hitlers Flucht. Es ist die Aktivierung dessen, was Foucault als „unterworfenes Wissen“ (savoirs assujettis) bezeichnet: historische Wahrheiten, die von dominanten, „offiziellen“ Narrativen disqualifiziert oder an den Rand gedrängt werden.13
Die dominante Nachkriegserzählung präsentierte ein sauberes Ende: Hitlers Selbstmord, der Fall Berlins, die Nürnberger Prozesse. Die historische Realität der sogenannten „Rattenlinien“, über die Tausende von Nationalsozialisten, darunter hochrangige Kriegsverbrecher wie Adolf Eichmann und Josef Mengele, mit Hilfe von Sympathisanten nach Argentinien und in andere südamerikanische Länder flohen, kompliziert dieses ordentliche Bild erheblich.43 Indem Brooks seinen Rap mit dieser Zeile beendet, holt er dieses unbequeme, unterworfene Wissen an die Oberfläche eines Mainstream-Popsongs. Dies ist ein zutiefst subversiver Akt, der das bereinigte Verständnis des Publikums von der Nachkriegsgeschichte und der damit verbundenen Gerechtigkeit in Frage stellt.
„One way ticket to Argentina“ aktiviert damit gteiltes Wissen über Flucht‑Routen (Ratlines) und Täterexil (Eichmann, Mengele). Der Witz banalisiert nicht die Verbrechen, sondern die Täter— Hitler als feiger Fliehender statt dämonischer Endzeitfigur. Das ist Entmythisierung durch Reduktion der Transzendenz—bei gleichzeitiger Verkürzung historischer Komplexität zur Pointe 64-65.
3.2 Latoursche Netzwerkanalyse: Die Assemblage des Artefakts
Die Aktanten im Netzwerk
Um die volle Wirkung des „Hitler Rap“ zu verstehen, muss man das heterogene Netzwerk analysieren, das ihn hervorgebracht hat und durch das er zirkulierte. Die folgende Tabelle skizziert die wichtigsten menschlichen und nicht-menschlichen Aktanten und ihre Rollen.
| Aktant (Menschlich/Nicht-menschlich) | Rolle im Netzwerk | Beobachtete Handlungsfähigkeit/Wirkung |
| Mel Brooks (Menschlich) | Autor, Performer, jüdischer Zeuge, Legitimierer | Verleiht dem Projekt satirische Absicht und moralische Legitimität; seine Identität verankert die Bedeutung als Widerstandsakt. |
| Das Rap-Genre (Nicht-menschlich) | Rhythmischer und linguistischer Rahmen | Übersetzt die historische Erzählung in Angeberei und Reim, macht sie für ein jugendliches Publikum „cool“ und zugänglich. |
| MTV/Musikvideo (Nicht-menschlich) | Distributions- und Ästhetikplattform | Standardisiert die visuelle Sprache, schreibt das Video in ein globales Jugendkultur-Netzwerk ein und sorgt für massenhafte Verbreitung. |
| Die Nazi-Uniform (Nicht-menschlich) | Potentes Symbol | Dient als visueller Auslöser, der sofort historische Konnotationen von Macht und Schrecken aktiviert, die dann durch die Performance untergraben werden. |
| Die Pop-Charts (Nicht-menschlich) | Mechanismus zur Wertbemessung | Verleihen dem Lied kommerziellen Erfolg und kulturelle Relevanz, was seine Reichweite und Wirkung verstärkt.1 |
Der Prozess der Übersetzung
Die Analyse dieses Netzwerks zeigt den Prozess der „Übersetzung“. Das Netzwerk nimmt den Aktanten „Hitler/Nationalsozialismus“ (ein Komplex aus historischem Schrecken, Trauma und politischer Ideologie) und übersetzt ihn in den Aktanten „Hitler Rap“ (ein 7-minütiges Pop-Produkt). Bei diesem Prozess wird die historische Komplexität notwendigerweise deformiert – sie wird zu Reimpaaren vereinfacht. Der Schrecken wird in Farce übersetzt. Genau in diesem Mechanismus liegen sowohl die Kraft als auch das Risiko des Videos.
Lyrik und audiovisiuelle Performance: Wie Popformate Wahrnehmung verschieben
Rappende Täter‑Stimme als Parodie der Autorität
Der Rap gibt Hitler die Ich‑Stimme, aber nur, um sie zu entmächtigen: Duktus, Reim und Groove degradieren den pseudo‑sakralen Ton NS‑propagandistischer Rhetorik. Affektverschiebung vom Erhabenen zum Grotesken—gestützt durch Camp‑ und Musical‑Gesten 54.
Hooklines, Tanz, Ohrwurm: Risiko der Ästhetisierung?
Popformate bergen die Gefahr, problematische Zeichen „gängig“ zu machen. Susan Sontags Diagnose der Faszination des Faschismus mahnt: Uniform, Ordnung, Körper können als ästhetische Reize wirken, wenn der satirische Rahmen verblassen sollte. Brooks kontert dies, indem er die Täterfigur sexuell unattraktiv, tölpelhaft und lächerlich zeichnet; das Risiko bleibt jedoch strukturell bestehen62.
Die Handlungsfähigkeit des Videos, Rezeption und Wirkung
Einmal veröffentlicht, agierte das Video in der Welt auf eine Weise, die Brooks nicht vollständig kontrollieren konnte. Es reiste durch internationale Netzwerke, generierte Kontroversen, Lachen und funktionierte für einige sogar als unbeabsichtigte Geschichtsstunde.3 Das Video ist also kein passives Objekt, sondern ein Akteur, der Wirkungen erzeugt (wie Bildung oder Trivialisierung), die emergente Eigenschaften des Netzwerks sind und nicht allein auf die Absicht des Autors zurückgeführt werden können.
Die Gesamtrezeption zeigt Evidenz für die Entmystifizierung des Nationalsozialismus. Brooks’ Programmatik (Spott entmachtet), die Idiotisierung der Täterstimme, die Argentinien‑Pointe und die internationale Rezeption sprechen für eine dominante entzaubernde Lesart 55-57, 64-65.
Gleichzeitig zeigte sich im deutschen Juste Millieu, insbesondere im Bereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eine Gegenbefürchtung: Kann durch Mel Brooks, dem jüdischen Melvin Kaminsky aus Brooklyn plötzlich wider der Nationalsozialismus schick gemacht werden? Deutsche Gatekeeping‑Entscheidungen (Rücknahmen) belegen die Sorge vor Missdeutungen; Pop‑Affekte können in Teilmilieus ästhetische Anschlussfähigkeit erzeugen. Diese Ambivalenz gehört konstitutiv zur Pop‑Satire über NS‑Zeichen (Iconoclash) 61, 65.
Teil IV: Schlussfolgerung – Entmystifizierung oder Re-Ästhetisierung?
4.1 Synthese der Befunde: Der Erfolg des Gegendiskurses
Aus einer Foucault’schen Perspektive ist das Projekt ein durchschlagender Erfolg. Indem es die Kernelemente des NS-Diskurses – seine Ästhetik der Macht, seine Legitimitätsansprüche, seine historische Grandiosität – angreift und unterworfenes Wissen über sein unwürdiges Ende an die Oberfläche bringt, funktioniert Brooks‘ Werk als ein exemplarischer Gegendiskurs. Es erreicht sein erklärtes Ziel, das Monströse lächerlich zu machen. Damit reiht es sich in eine breitere Tradition des Holocaust-Humors ein, der als ein wesentliches Werkzeug für psychologisches Überleben, Widerstand und Erinnerungsarbeit anerkannt ist.49
Nach Foucault muß man schlußfolgern: Brooks verschiebt die Regeln der Sagbarkeit, indem er eine nicht‑ernste Form wählt, die „Ernst‑Rituale“ bricht; seine Autorfunktion legitimiert dies partiell. Institutionelle Reaktionen (Ausschluss, Rücknahmen) zeigen die Macht diskursiver Rituale; Chart‑Erfolge offenbaren ihre Begrenztheit 59-60, 66.
4.2 Die Paradoxie der Übersetzung: Das Risiko des Netzwerks
Die Latour’sche Analyse beleuchtet jedoch das Gegenargument. Der Prozess der „Übersetzung“, der notwendig ist, um den Gegendiskurs durch ein popkulturelles Netzwerk reisen zu lassen, erfordert Vereinfachung und Ästhetisierung. Die Gefahr besteht darin, daß für einige Knotenpunkte im Netzwerk (d. h. für ein Publikum, das mit dem Kontext nicht vertraut ist) die „Deformation“ total ist. Die Symbole (Hakenkreuz, Uniform) können von ihrem Referenten (Völkermord) losgelöst und als reine Pop-Art-Ikonografie neu eingeschrieben werden. Dies erklärt die anhaltende Kritik, daß solche Werke die Geschichte trivialisieren oder von „krassem schlechten Geschmack“ zeugen.7 Das Netzwerk selbst hat keinen inhärenten moralischen Kompass; es übersetzt und überträgt lediglich. Jedoch gleichzeitig: Das Video fungiert als Mediator in einem Netzwerk heterogener Akteure. Die Kontroverse erzeugt Bedeutungen (Skandal, Debatten, Käufe) jenseits der ursprünglichen Intention. Der dauerhafte Streit um NS‑Bilder ist ein Iconoclash: Entzauberung und Rest‑Faszination bleiben unentwirrbar verflochten 61-62.
4.3 Schlussbewertung: Brooks als stabilisierender Akteur im Netzwerk
Die endgültige Bewertung muss diese Spannung auflösen. Es wird argumentiert, daß in diesem spezifischen Akteur-Netzwerk das Risiko der Re-Ästhetisierung durch die überwältigende Kraft seines zentralen menschlichen Aktanten gemindert wird: Mel Brooks selbst. Seine unbestreitbare jüdische Identität, seine persönliche Geschichte mit dem Zweiten Weltkrieg und seine explizite, oft wiederholte philosophische Absicht wirken als starker Anker, der die Bedeutung des Netzwerks stabilisiert. Für die überwiegende Mehrheit des Publikums ist es unmöglich, den „Hitler Rap“ von dem Wissen zu trennen, daß er von einem Juden als Akt des Trotzes aufgeführt wird. Dieser Kontext verhindert, daß der Übersetzungsprozess das Zeichen vollständig von seiner Geschichte abkoppelt. Gemäß dem Foucaultschen Diktum: Nicht jeder kann über alles reden66, muß man hier sagen: Brooks kann, darf und das ist gut so!
Die Genialität des Werks von 1983 liegt somit in seiner Fähigkeit, ein Netzwerk aufzubauen, das stark genug ist, um in die Mainstream-Kultur einzudringen, während es gleichzeitig einen zentralen Akteur besitzt, der stark genug ist, um zu verhindern, daß dieses Netzwerk in reine, bedeutungslose Ästhetik kollabiert. „The Hitler Rap“ instrumentalisiert erfolgreich die Mechanismen des populären Diskurses, um einen politischen Schrecken anzugreifen. Er demonstriert, daß der effektivste Widerstand manchmal nicht darin besteht, das System abzulehnen, sondern es zu kapern und für die eigenen subversiven Zwecke zu nutzen.
Die Entmystifizierung des Nationalsozialismus, der insbesondere in Deutschland als Einzigartigkeit der deutschen Geschichte auf einen seltsamen, besonderen Sockel gehoben wurde, wird bei Mel Brooks perfektioniert. Befremdete Beobachter des deutschen Diskurses haben fast das Gefühl, als ob diese Einzigartigkeit als Alleinstellungsmerkmal des “Keiner ist böser als wir und daher sind wir besonders großartig” inzwischen Einzug gehalten hat. Brooks’ Parodie degradiert die Täterstimme, entzieht NS‑Rhetorik ihre Aura und verankert die Figur Hitler im Lächerlichen. Die Pop‑Form ist dabei zweischneidig: Sie kann in kontextarmen Rezeptionen ästhetische Anschlussfähigkeit erzeugen; in gut situierten Lesarten überwiegt jedoch die entzaubernde Wirkung. Die Argentinien‑Zeile fungiert als prägnanter Marker für die Banalisierung der Täter—und damit gegen ihre mythische Überhöhung1-4, 62-66.
Referenzen
- To Be or Not to Be (The Hitler Rap) – Wikipedia, Zugriff am September 4, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/To_Be_or_Not_to_Be_(The_Hitler_Rap)
- To Be or Not To Be: Mel Brooks – Hitler Rap (1983) – YouTube, Zugriff am September 4, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=kmzPnpn63nA
- Random Jaw-Dropping 80’s Moment: The Hitler Rap | The Axis of Ego, Zugriff am September 4, 2025, https://theaxisofego.com/2011/02/26/random-jaw-dropping-80s-moment-the-hitler-rap/
- SPIEGEL Interview with Mel Brooks: “With Comedy, We Can Rob Hitler of his Posthumous Power”, Zugriff am September 4, 2025, https://www.spiegel.de/international/spiegel/spiegel-interview-with-mel-brooks-with-comedy-we-can-rob-hitler-of-his-posthumous-power-a-406268.html
- It’s the same reason Mel Brooks made a comedy movie about the Nazis. He said that making fun of Hitler, turning him into something to point and laugh at, robbed him of the power and symbolism he had… – Sam W – World-Weary Writer – Medium, Zugriff am September 4, 2025, https://medium.com/@woodspathfinder/its-the-same-reason-mel-brooks-made-a-comedy-movie-about-the-nazis-689d69b3c1ec
- “The only weapon I’ve got is comedy” – Mel Brooks | Asheville Community Theatre, Zugriff am September 4, 2025, https://ashevilletheatre.org/the-only-weapon-ive-got-is-comedy-mel-brooks/
- To Be Or Not To Be Review – What The Craggus Saw, Zugriff am September 4, 2025, https://thecraggus.com/2024/04/17/to-be-or-not-to-be-review/
- Mel Brooks: The Satire of Everything | by Debaser – Medium, Zugriff am September 4, 2025, https://medium.com/@debasermaas/mel-brooks-the-satire-of-everything-ff099b6ab797
- Foucault: Power, Knowledge, and Discourse | History of Modern Philosophy Class Notes, Zugriff am September 4, 2025, https://library.fiveable.me/history-modern-philosophy/unit-12/foucault-power-knowledge-discourse/study-guide/4jvEOQWcsDhgJk8l
- Foucault: power is everywhere | Understanding power for social …, Zugriff am September 4, 2025, https://www.powercube.net/other-forms-of-power/foucault-power-is-everywhere/
- Power and Resistance: Exploring Michel Foucault’s Concept of Power Dynamics – Medium, Zugriff am September 4, 2025, https://medium.com/@sambhavjain.mail/power-and-resistance-exploring-michel-foucaults-concept-of-power-dynamics-81bec544863b
- Power-knowledge – Wikipedia, Zugriff am September 4, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Power-knowledge
- Power/Knowledge by Michel Foucault | Research Starters – EBSCO, Zugriff am September 4, 2025, https://www.ebsco.com/research-starters/literature-and-writing/powerknowledge-michel-foucault
- Michel Foucault: Discourse – Critical Legal Thinking, Zugriff am September 4, 2025, https://criticallegalthinking.com/2017/11/17/michel-foucault-discourse/
- A Discourse Analysis of Satirical Resistance to Foucault’s Concept of Power, Zugriff am September 4, 2025, https://gsbooks.gs.kku.ac.th/55/cdgrc13/files/hmo13.pdf
- Discourse/Counter-Discourse: The Theory and Practice of Symbolic Resistance in Nineteenth-Century France 9781501717611 – DOKUMEN.PUB, Zugriff am September 4, 2025, https://dokumen.pub/discourse-counter-discourse-the-theory-and-practice-of-symbolic-resistance-in-nineteenth-century-france-9781501717611.html
- Transgressive Acts: Michel Foucault’s Lessons on Resistance for Nurses – PubMed Central, Zugriff am September 4, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11610671/
- Actor–network theory – Wikipedia, Zugriff am September 4, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Actor%E2%80%93network_theory
- Please help with Actor-Network Theory : r/sociology – Reddit, Zugriff am September 4, 2025, https://www.reddit.com/r/sociology/comments/546w0i/please_help_with_actornetwork_theory/
- Latour’s Actor Network Theory – Simply Psychology, Zugriff am September 4, 2025, https://www.simplypsychology.org/actor-network-theory.html
- www.simplypsychology.org, Zugriff am September 4, 2025, https://www.simplypsychology.org/actor-network-theory.html#:~:text=Actor%20network%20theory%20fundamentally%20consists,all%20actors%20are%20themselves%20assemblages.
- Actor-Network Theory and Methodology: Just What Does It Mean to Say That Nonhumans Have Agency? – ResearchGate, Zugriff am September 4, 2025, https://www.researchgate.net/publication/270626002_Actor-Network_Theory_and_Methodology_Just_What_Does_It_Mean_to_Say_That_Nonhumans_Have_Agency
- Actor Network Theory and Sleep – Medium, Zugriff am September 4, 2025, https://medium.com/@foleysarah/actor-network-theory-and-sleep-c9b9ef2e4e43
- Bruno Latour’s Actor-Network Theory: Rethinking Social Connections – YouTube, Zugriff am September 4, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=7DVlNwBrSj8&pp=0gcJCfwAo7VqN5tD
- Mel Brooks famously said that “by using the medium of comedy, we can try to rob Hitler of his posthumous power and myths.” But what if someone could ride an ironic wave to the top? – Cannonball Read, Zugriff am September 4, 2025, https://cannonballread.com/2015/04/mel-brooks-famously-said-that-by-using-the-medium-of-comedy-we-can-try-to-rob-hitler-of-his-posthumous-power-and-myths-but-what-if-someone-could-ride-an-ironic-wave-to-the-top/
- Mel Brooks | My Jewish Learning, Zugriff am September 4, 2025, https://www.myjewishlearning.com/article/mel-brooks/
- Mel Brooks – Wikipedia, Zugriff am September 4, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Mel_Brooks
- The Comedy Writer: Mel Brooks | Podcast | American Masters – PBS, Zugriff am September 4, 2025, https://www.pbs.org/wnet/americanmasters/podcast/comedy-writer-mel-brooks/
- A history of Mel Brooks as a ‚disobedient Jew‘ | The Times of Israel, Zugriff am September 4, 2025, https://www.timesofisrael.com/a-history-of-mel-brooks-as-a-disobedient-jew/
- Mel Brooks‘ Final Message: „I’m a Jew, What’s Wrong With That!“ – YouTube, Zugriff am September 4, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=eU8zYqBE3bo
- Mel Brooks: To Be Or Not To Be; The Hitler Rap (1984) | Elsewhere by Graham Reid, Zugriff am September 4, 2025, https://www.elsewhere.co.nz/fromthevaults/3801/mel-brooks-to-be-or-not-to-be-the-hitler-rap-1984/
- Mel Brooks‘ Subversive Cabaret. The Producers (1968) – ResearchGate, Zugriff am September 4, 2025, https://www.researchgate.net/publication/337950181_Mel_Brooks’_Subversive_Cabaret_The_Producers_1968
- The Producers (1967 film) – Wikipedia, Zugriff am September 4, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/The_Producers_(1967_film)
- What was the complementary reaction to Mel Brooks „The Producers“? It seems like it would have been a pretty controversial topic. : r/AskHistorians – Reddit, Zugriff am September 4, 2025, https://www.reddit.com/r/AskHistorians/comments/143m8xf/what_was_the_complementary_reaction_to_mel_brooks/
- To Be or Not to Be (film) | EBSCO Research Starters, Zugriff am September 4, 2025, https://www.ebsco.com/research-starters/film/be-or-not-be-film
- To Be or Not to Be (1942) | The Definitives | Deep Focus Review, Zugriff am September 4, 2025, https://www.deepfocusreview.com/definitives/to-be-or-not-to-be/
- To Be or Not to Be (1983) – The Postmodern Pelican, Zugriff am September 4, 2025, https://postmodernpelican.com/2025/01/22/to-be-or-not-to-be-1983/
- ‚To Be or Not to Be‘: 1942 or 1983? – MovieBabble, Zugriff am September 4, 2025, https://moviebabble.com/2020/05/13/to-be-or-not-to-be-1942-or-1983/
- Actors taking on tyrants: Ernst Lubitsch’s ‚To Be or Not to Be‘ | Folger Shakespeare Library, Zugriff am September 4, 2025, https://www.folger.edu/blogs/shakespeare-and-beyond/ernst-lubitsch-to-be-or-not-to-be-actors-taking-on-tyrants/
- Nineteen Eighty-Four and the Tradition of Satire – Montclair State University, Zugriff am September 4, 2025, https://www.montclair.edu/profilepages/media/331/user/nineteeneightyfourandthetraditionofsatire.pdf
- Totalitarian Laughter: Cultures of the Comic under Socialism | Serguei A. Oushakine (Сергей Ушакин), Zugriff am September 4, 2025, https://oushakine.scholar.princeton.edu/publications/totalitarian-laughter-cultures-comic-under-socialism
- satire as a means of understanding totalitarian reality – AMERICAN JOURNALS, Zugriff am September 4, 2025, https://advancedscienti.com/index.php/AJEL/article/download/1109/2191
- www.thoughtco.com, Zugriff am September 4, 2025, https://www.thoughtco.com/why-did-argentina-accept-nazi-criminals-2136579#:~:text=Argentina%20accepted%20Nazis%20after%20WWII,allowed%20to%20escape%20to%20Argentina.
- Argentina – United States Department of State, Zugriff am September 4, 2025, https://www.state.gov/reports/just-act-report-to-congress/argentina
- Ratlines (World War II) – Wikipedia, Zugriff am September 4, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Ratlines_(World_War_II)
- Why Argentina Accepted Nazi War Criminals After World War II – ThoughtCo, Zugriff am September 4, 2025, https://www.thoughtco.com/why-did-argentina-accept-nazi-criminals-2136579
- Nazi Havens in South America – Aish.com, Zugriff am September 4, 2025, https://aish.com/nazi-havens-in-south-america/
- Why did so many so many Nazi fugitives flee to Argentina after WW2? : r/history – Reddit, Zugriff am September 4, 2025, https://www.reddit.com/r/history/comments/6idstk/why_did_so_many_so_many_nazi_fugitives_flee_to/
- Laughter in a Time of Tragedy: Examining Humor during the Holocaust – Denison Digital Commons, Zugriff am September 4, 2025, https://digitalcommons.denison.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1066&context=religion
- „Laughter in a Time of Tragedy: Examining Humor during the Holocaust“ by Whitney Carpenter – Denison Digital Commons, Zugriff am September 4, 2025, https://digitalcommons.denison.edu/religion/vol9/iss1/3/
- Humour and the Holocaust, Zugriff am September 4, 2025, https://europeanjournalofhumour.org/ejhr/article/download/588/595/2457
- A Laughing Matter? The Role of Humor in Holocaust Narrative by Hanni Meirich A Thesis Presented in Partial Fulfillment of the – CORE, Zugriff am September 4, 2025, https://core.ac.uk/download/pdf/79566609.pdf
- Springtime for Larceny: The Producers (1967) – Pale Writer, Zugriff am September 4, 2025, https://palewriter2.home.blog/2020/06/13/springtime-for-larceny-the-producers-1967/
- YouTube: Mel Brooks – „To Be or Not To Be (The Hitler Rap)“, Extended Version, 1983. (Abruf: Zugriff am September 4, 2025)
- Official Charts Company: „Mel Brooks – To Be Or Not To Be (The Hitler Rap)“ (Chart‑Historie, UK).
- Wikipedia (en): „To Be or Not to Be (1983 film)“; und/oder Wikipedia‑Eintrag zum Song (Chart‑Sektionen).
- Der Spiegel (2006): „With Comedy, We Can Rob Hitler of his Posthumous Power“ – Interview mit Mel Brooks, , Zugriff am September 4, 2025, https://www.spiegel.de/international/spiegel/spiegel-interview-with-mel-brooks-with-comedy-we-can-rob-hitler-of-his-posthumous-power-a-406268.html
- Michel Foucault (1971/1991): „Die Ordnung des Diskurses“ (frz. 1970).
- Michel Foucault (1969/1992): „Was ist ein Autor?“ (frz. 1969).
- Bruno Latour (2005): „Reassembling the Social: An Introduction to Actor‑Network‑Theory“, Oxford UP.
- Bruno Latour (2002): „What is Iconoclash?“ in: Iconoclash (Hg. Latour/Weibel), ZKM/Karlsruhe – MIT Press.
- Susan Sontag (1974/1980): „Fascinating Fascism“, New York Review of Books; in: Under the Sign of Saturn.
- Jewish Virtual Library: „Ratlines“ (Überblicksartikel zu Fluchten nach 1945). Zugriff am September 4, 2025, https://www.jewishvirtuallibrary.org/ratlines-nazi-escape-routes-after-world-war-ii
- Zeitgeschichtliche Dokumente zu Eichmann/Mengele (z. B. NARA/CIA‑Releases, Sekundärliteratur).
- Zeitgenössische deutschsprachige Presse/Wikipedia‑Zusammenfassungen zur BRD‑Rezeption (Ariola/WDR/Charts).
- Michel Foucault, The Order of Discourse / The Discourse on Language, in: The Archaeology of Knowledge (Appendix), Pantheon 1972 – die obige Passage steht gleich am Anfang (oft als S. 216 der engl. Ausgabe ausgewiesen), Zugriff am September 4, 2025, https://commons.princeton.edu/shakespeares-language/wp-content/uploads/sites/41/2017/09/Foucault-The-Discourse-on-Language.pdf
- Hartmut Schröder, Matthias Rothe (Hg.): Ritualisierte Tabuverletzungen, Lachkultur und das Karnevaleske. Frankfurt am Main et al.: Verlag Peter Lang 2002.
Transparenzhinweis: Selbstverständlich wurden bei der Erarbeitung dieses Textes KI Hilfsmittel verwendet.