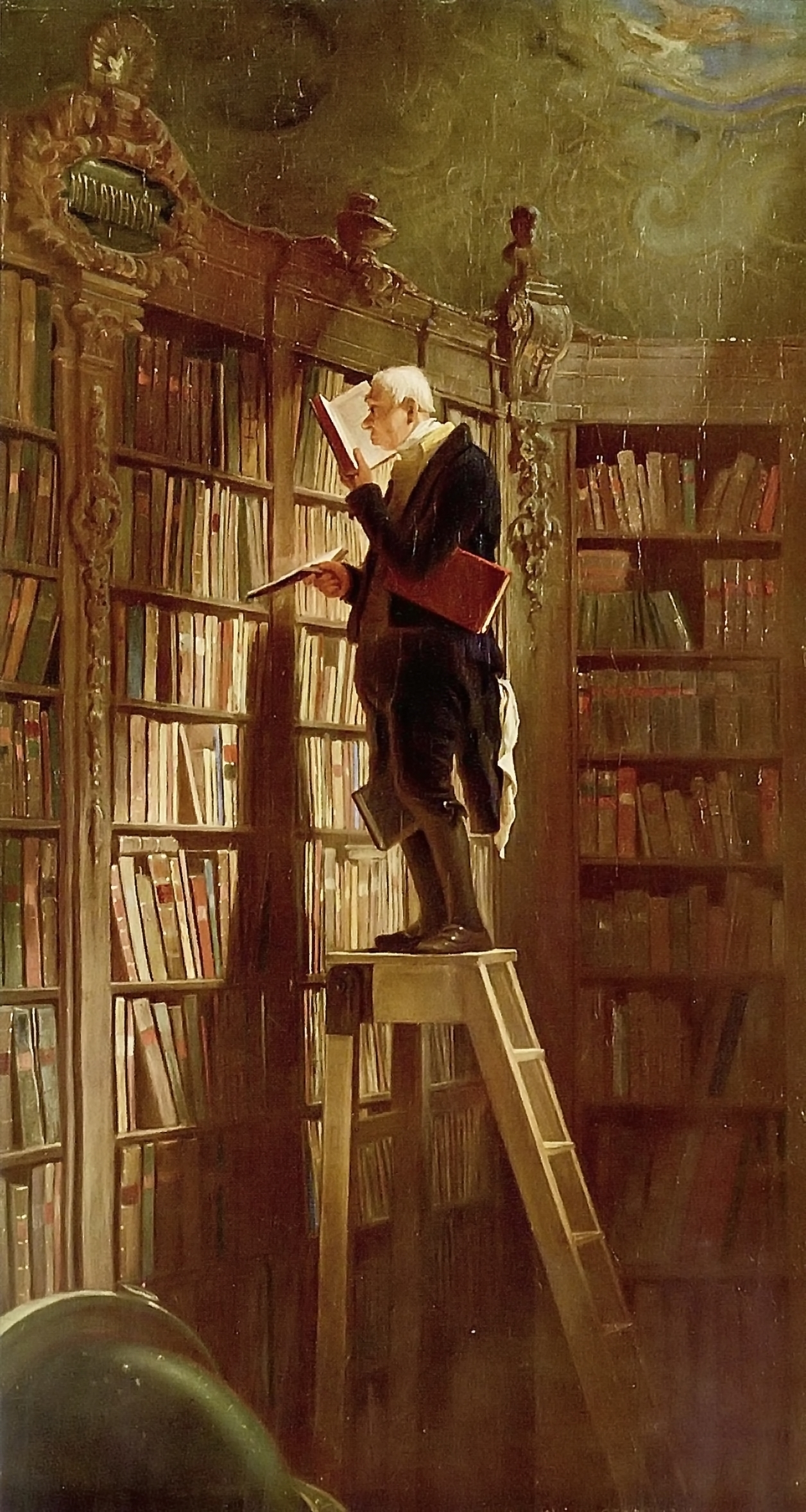von Dr. Christoph v. Gamm, Juni 2025
Sie scheißen nicht. Sie fluchen nicht. Sie trinken keine Kornmischung auf dem Aldi-Parkplatz, sie haben keine schlechte Haut, keinen unsauberen Charakter und schon gar keinen Mutterkomplex. Sie stehen über allem – moralisch, körperlich, seelisch – und bewegen sich durch die Literaturgeschichte wie mit Palmwedeln geleitete Gotteskinder.
Willkommen in der Parallelwelt der aalglatten Romanhelden.
Heldentum zum Abgewöhnen
Wer glaubt, das Gute müsse gelegentlich rülpsen, um glaubhaft zu bleiben, der hat in der deutschen Literatur schlechte Karten. Denn unsere Klassiker – und viele Jugendbücher – sind voll von Figuren, die sich nicht nur selbst entkoppelt haben, sondern gleich den gesamten Lesekosmos mit einer Art bleierner Vorbildlichkeit überziehen.
Man nennt das „erbauliche Literatur“. Wir nennen es: Heldenhafter Humanismus mit Brechreizgarantie.
Die Hall of Fame der Heiligkeit
Da wäre zum Beispiel Bibi Blocksberg, die kleine Hexe mit dem moralischen Kompass eines UNO-Vorsitzenden. Wenn sie Mist baut, ist es lehrreich. Wenn sie hex-hex sagt, ist es lösungsorientiert. Wenn sie verliert, dann nur, um später in einer Sonderfolge zu gewinnen. Ihre einzige reale Schwäche ist der Umstand, dass sie mit Boris verwandt ist – der wurde allerdings rechtzeitig ins Serien-Ausland abgeschoben.
Old Shatterhand wiederum ist so integer, dass man ihm direkt das Grundgesetz anvertrauen könnte – selbst in einer Talkshow mit Sahra Wagenknecht. Seine einzige Sünde besteht darin, Pferde mit einem einzigen Faustschlag zu Boden zu schicken. Doch selbst das macht er ethisch reflektiert.
Harry Potter, obwohl kein deutscher Export, wurde in den Regalen der Hugendubel-Republik zu einer Art Ersatz-Messias für die Gymnasialstufe. Ein bisschen Emo in Band 5, ja. Aber nie wirklich daneben. Nie mal eine ordentliche Kneipenschlägerei. Kein Sex mit Cho Chang. Nicht einmal ein Joint mit Hagrid.
Warum das nervt – Psychologisch betrachtet
Was all diese Figuren gemeinsam haben:
Sie entwickeln sich nicht, sie verzweifeln nicht, sie verlieren nicht die Kontrolle.
Kurz: Sie sind für literarische Reibung ungefähr so nützlich wie veganes Hack für eine Wirtshauskneipe in Niederbayern.
Dabei wissen wir längst aus der Erzähltheorie: Wahre Größe entsteht im Dreck.
Die besten Figuren sind die, die wanken, die ausrasten, die scheitern und sich dann irgendwie – halb blutig, halb besoffen – wieder zusammenflicken.
Doch unsere aalglatten Helden? Die wanken nicht. Die tragen keine Haut, sondern Teflon.
Kulturdiagnose: Deutschland, das Land der „Guten Schüler“
Diese Heldentypen sagen auch etwas über uns selbst. Über ein Land, das im Zweifel lieber Ordnung predigt als Wildheit aushält. Das lieber „brav“ liest als mitfiebert.
Man darf scheitern – aber bitte strukturiert.
Man darf fühlen – aber bitte mit Bildungsauftrag.
Und wehe, jemand ist ambivalent – da kommt gleich der Deutschlehrer mit dem Thomas-Mann-Seminarzettel.
Ein Gegenvorschlag: Das Zeitalter des literarischen Ungeziefers
Was wir brauchen, sind neue Helden:
Solche, die sich in der U-Bahn prügeln, weil ihnen jemand die Bio-Gurke aus dem Jutebeutel geklaut hat.
Die beim Jugendamt heulen, weil ihnen niemand glaubt.
Die auf Twitter unüberlegte Memes posten – und dafür ein SEK-Kommando vor der Tür haben.
Figuren, die man nicht bewundert, sondern kennt.
Oder um es mit Problempony-Charakter Karin M. zu sagen:
„Ich will keine Heiligen. Ich will Menschen, die sich auch mal danebenbenehmen – und es trotzdem gut meinen.“
Fazit: Mehr Dreck, bitte. Mehr Drama. Mehr echte Menschlichkeit.
Die aalglatten Helden mögen Bestseller sein – aber sie sind seelenlos.
Was bleibt, ist der Wunsch nach Geschichten, in denen sich Moral nicht an der Abwesenheit von Scheitern misst, sondern an der Art, wie man wieder aufsteht. Mit zerfledertem Pony, verrutschter Frisur und einem mittelguten Anwalt an der Seite.
Denn am Ende lieben wir keine perfekten Menschen, nicht die Abziehbilder ihrer narzisstischen Autoren. Wir lieben ehrlich Kaputte mit Macken.