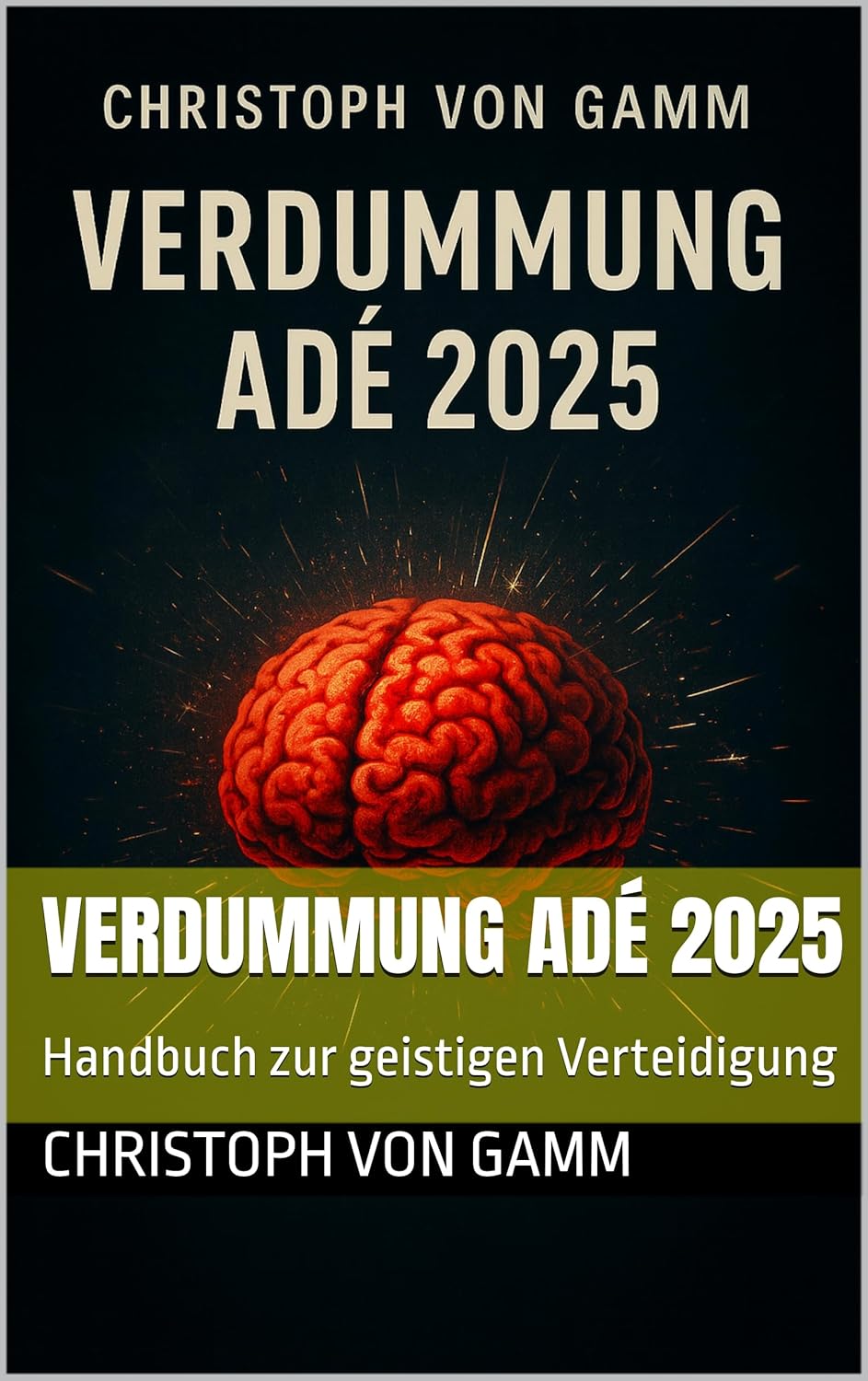Verdummung Adé 2025
Buchauszug. Das Buch erscheint im September 2025 auf Amazon:
Verdummung Adé 2025: Handbuch zur geistigen Verteidigung
Die Welt ist komplex – aber der Diskurs ist dumm geworden. In dieser stark erweiterten Neuauflage seines Kultbuchs von 2016 rechnet Dr. Christoph von Gamm mit Sprachverdrehung, moralischer Erpressung, Cancel Culture, Klima-Dogmatik und künstlicher Intelligenz als neuer Kirchenmacht ab.
Verdummung durch Wissenschaftsbeugung: Die ökosozialistische Transformation der deutschen Rechtswissenschaft
von Dr. Christoph von Gamm, August 2025
Einleitung: Die neue Werthlosigkeit der Jurisprudenz
Im Jahre 1847 hielt der preußische Staatsanwalt Julius von Kirchmann einen Vortrag, der in die Annalen der juristischen Selbstzerfleischung eingehen sollte: „Die Werthlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft“.1 Seine berühmteste und zugleich vernichtendste Sentenz lautete: „Drei berichtigende Worte des Gesetzgebers, und ganze Bibliotheken werden zu Makulatur“.1 Kirchmann beklagte die Abhängigkeit der Rechtswissenschaft von der Willkür des positiven Gesetzes, das ihr jeden Anspruch auf ewige Wahrheit und damit auf den Status einer echten Wissenschaft nehme.1 Die Jurisprudenz, so sein Bild, sei wie ein Wurm, der sich vom faulen Holze nähre; sie niste im Kranken und wende sich vom Gesunden ab.1
Mehr als 175 Jahre später steht die deutsche Rechtswissenschaft erneut an einem Abgrund, doch die Vorzeichen haben sich auf perfide Weise verkehrt. Die heutige Krise entspringt nicht der Ohnmacht gegenüber einem launischen Gesetzgeber, sondern der aktiven, selbstgewählten Unterwerfung unter eine allgegenwärtige ideologische Agenda. Die neue Werthlosigkeit der Jurisprudenz resultiert nicht aus ihrer Irrelevanz, sondern aus ihrer freiwilligen Korruption. Eine systematische Maschinerie des „Agenda-Setting“ hat die Disziplin gekapert und steuert sie in ein ökosozialistisches Paradigma, das wissenschaftliche Neutralität und dogmatische Strenge auf dem Altar des politischen Aktivismus opfert.
Während Kirchmann die Machtlosigkeit der Wissenschaft vor dem Gesetz beklagte, erleben wir heute die proaktive Machtergreifung durch juristische Akteure – Aktivisten, Richter, Akademiker –, die das Recht nicht mehr als stabilisierenden Rahmen, sondern als transformatives Werkzeug begreifen. Sie agieren nicht reaktiv, sondern gestalten die rechtliche und politische Realität durch strategische Klagen, mediale Kampagnen und die gezielte Umdeutung von Normen.2 Das Problem ist nicht mehr, dass die Rechtswissenschaft eine schwache Wissenschaft ist, sondern dass sie zu einem mächtigen politischen Instrument verkommen ist. Sie gibt nicht einmal mehr vor, den „Anschein der Neutralität“ 4 wahren zu wollen, sondern bekennt sich offen zu ihrer politischen Mission. Die Erkenntnis, dass Rechtsdogmatik nie ein steriles, wertfreies Geschäft, sondern immer auch von „Politik, Ideologie und Wertdenken“ durchdrungen ist 5, wird nicht mehr als Mahnung zur Selbstreflexion verstanden, sondern als Freibrief zur hemmungslosen Politisierung. Die Jurisprudenz hat ihre Rolle als neutrale Schiedsrichterin aufgegeben und ist zur Parteigängerin einer ganz bestimmten Weltsicht geworden. Ihre neue Werthlosigkeit ist selbstverschuldet.
Kapitel 1: Die Agenda-Maschinerie – Wie man eine Wissenschaft kapert
Die Transformation der Rechtswissenschaft vollzieht sich nicht zufällig, sondern folgt einer präzisen Mechanik, die in den Kommunikationswissenschaften als „Agenda-Setting“ bekannt ist. Diese Theorie beschreibt den Prozess, durch den Medien und andere einflussreiche Akteure nicht notwendigerweise bestimmen, was die Menschen denken, aber sehr wohl, worüber sie nachdenken.6 Durch die ständige, prominente Platzierung bestimmter Themen wird deren wahrgenommene Wichtigkeit (Salience) in der Öffentlichkeit künstlich erhöht.9 Dieser Mechanismus ist der Motor, der eine spezifische Ideologie in das Zentrum des juristischen und politischen Diskurses katapultiert hat: den Ökosozialismus.
Die Theorie des Agenda-Setting und ihre Akteure
Der Prozess des Agenda-Setting ist ein Zusammenspiel verschiedener Akteure. Medienorganisationen, Interessengruppen, Lobbyisten und politische Akteure wählen gezielt Themen aus, wiederholen sie persistent und rücken bestimmte Aspekte in den Vordergrund, während andere vernachlässigt werden.7 Dies geschieht durch die Auswahl von Nachrichtenthemen, die Häufigkeit der Berichterstattung und die Art der Rahmung („Framing“).7 Im juristischen Kontext ist dieser Prozess von besonderer Bedeutung, da er direkt auf die Gesetzgebung einwirkt. Themen werden zu politischen Prioritäten gemacht, was zur Schaffung neuer Gesetze oder zur Umgestaltung der bestehenden Rechtsordnung führt.11 Ein klassisches Beispiel ist die Einführung des Mindestlohns, die erst nach jahrelanger Thematisierung durch Gewerkschaften und Medien auf die politische Agenda gelangte.11 Heute wird derselbe Mechanismus genutzt, um weitaus radikalere Ziele durchzusetzen. Strategische Klagen und die gezielte Verbreitung von Rechtsgutachten durch Interessengruppen sind dabei zentrale Instrumente, um Druck aufzubauen und den Policy-Cycle zu beeinflussen.2
Definition der Agenda: Der Ökosozialismus
Die Ideologie, die durch diese Maschinerie vorangetrieben wird, ist der Ökosozialismus. Dieser Begriff ist keine polemische Zuschreibung von außen, sondern eine Selbstbezeichnung relevanter politischer und zivilgesellschaftlicher Akteure. Er taucht in parlamentarischen Debatten auf 13, wird zur Klassifizierung politischer Strömungen wie bei den Grünen verwendet 14 und ist Gegenstand akademischer Analysen.16
Die Grundsätze dieser Ideologie werden am klarsten in den programmatischen Schriften von Vordenkern wie der Rosa-Luxemburg-Stiftung dargelegt. Dort wird offen die Kritik an der „fossil-kapitalistischen Produktions- und Lebensweise“ formuliert, die als existenzbedrohend dargestellt wird.18 Das Ziel ist nichts Geringeres als ein „sozial-ökologischer Umbau“, der als Einstieg in eine „radikale Veränderung der Produktions- und Lebensweisen“ dient.18 Kern der Analyse ist die Annahme, dass die ökologische Krise untrennbar mit dem „Wachstumszwang der kapitalistischen Produktionsweise“ verbunden ist.18 Folgerichtig umfasst das alternative Gesellschaftsmodell alle Lebensbereiche 19 und fordert den gezielten „Um- und Rückbau“ ganzer Industriezweige wie der Automobil-, Chemie- oder Bauindustrie.20 Schlagworte wie „Wirtschaftsdemokratie“, „Klimagerechtigkeit“, „Energiedemokratie“ und „Ernährungssouveränität“ bilden die konzeptionellen Bausteine für diese grundlegende Neuordnung von Wirtschaft und Gesellschaft.18
Der sich selbst verstärkende Kreislauf
Die Implementierung dieser Agenda im Rechtssystem folgt einem perfiden, sich selbst verstärkenden Kreislauf, der gegen demokratische Korrekturen weitgehend immun ist. Er operiert auf einer vor- und para-politischen Ebene und prägt die Sprache und den konzeptionellen Rahmen, innerhalb dessen Gesetze überhaupt erst debattiert und formuliert werden.
- Thematisierung und Moralisierung: Ein Thema wie die „Klimakrise“ wird von Aktivistengruppen und Medien als existenzielle, moralisch alternativlose Bedrohung gerahmt.7
- Politischer Druck: Dies erzeugt öffentlichen Druck und eine Atmosphäre der Dringlichkeit, in der politisches Zögern oder Abwägen als verantwortungslos erscheint.11
- Symbolische Gesetzgebung: Die Legislative reagiert mit vage formulierten Rahmengesetzen (z. B. Klimaschutzgesetz), die ambitionierte Ziele festschreiben, aber die konkreten, schmerzhaften Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele bewusst offenlassen.22
- Strategische Prozessführung: Aktivistische Organisationen nutzen diese Gesetze als juristische Waffe und verklagen die Regierung wegen Nichterfüllung ihrer selbst gesetzten, aber unkonkretisierten Ziele.23
- Judikative Aktivierung: Gerichte, die im selben agenda-getriebenen Klima agieren, interpretieren die Rahmengesetze extensiv und zwingen die Regierung zur Umsetzung radikalerer Maßnahmen, als sie im demokratischen Prozess ausgehandelt wurden.2
- Mediale Bestätigung: Das Gerichtsurteil wird von Medien und Aktivisten als Sieg für die „gute Sache“ gefeiert, was die ursprüngliche Agenda bestätigt und den Kreislauf für die nächste Verschärfung von Neuem in Gang setzt.2
Das Recht dient hier nicht mehr als stabiler Rahmen, sondern als ideologischer Sperrklinkenmechanismus, der nur eine Richtung kennt: die fortschreitende Transformation im Sinne der vorgegebenen Agenda.
Kapitel 2: Der Verlust der Mitte – Von der Rechtsdogmatik zur Gesinnungsjurisprudenz
Die Injektion einer politischen Ideologie in das Rechtssystem durch die Agenda-Maschinerie bleibt nicht ohne Folgen für das Herzstück der Jurisprudenz: die Rechtsdogmatik. Wir erleben einen fundamentalen Zerfallsprozess, bei dem das klassische Ideal eines neutralen, systematischen und kohärenten Rechtssystems durch eine „Gesinnungsjurisprudenz“ ersetzt wird. Dieser Wandel ist nicht nur eine inhaltliche Neuausrichtung, sondern ein intellektueller Abstieg, eine Form der „Verdummung“, bei der die komplexe juristische Analyse der Erreichung vorab festgelegter politischer Ziele untergeordnet wird.
Das Ideal der Rechtsdogmatik und seine Aushöhlung
Die Rechtsdogmatik ist die Wissenschaft vom geltenden Recht (lex lata).25 Ihr Ziel ist es, aus der unübersichtlichen Masse von Gesetzen und Urteilen ein inneres, widerspruchsfreies System zu schaffen, das auf anerkannten Grundsätzen, Definitionen und der herrschenden Meinung (h.M.) beruht.25 Sie dient der Rechtssicherheit, der Vorhersehbarkeit von Entscheidungen und der Gleichbehandlung. Sie ist das rationale Fundament, das das Recht von bloßer Willkür unterscheidet.
Doch dieses Fundament erodiert. Zwar war die Dogmatik nie ein rein technisches, wertfreies Geschäft, sondern stets von außerrechtlichen Vorprägungen, Politik und Ideologie beeinflusst.5 Die gegenwärtige Entwicklung aber instrumentalisiert diese Tatsache und erhebt die Ideologie zum obersten Auslegungsprinzip. Als warnendes historisches Beispiel dient die nationalsozialistische Rechtslehre. Auch damals wurde die Rechtsordnung funktional umgewidmet, um einem übergeordneten Ziel zu dienen: der „Umformung der Vielheit einer Gesellschaft in die Einheit einer Gemeinschaft“.27 Unter der Parole „Gemeinnutz geht vor Eigennutz“ wurden subjektive Rechte des Einzelnen aufgelöst und zu bloßen Funktionen im Dienste der „Volksgemeinschaft“ umdefiniert.27 Das Individuum erhielt seine Rechte nicht mehr als solches, sondern nur, „wenn und soweit er in dieser Gemeinschaft steht und wirkt“.27 Diese funktionale Unterordnung des Individuums und seiner Rechte unter ein abstraktes Kollektivziel weist beunruhigende strukturelle Parallelen zu heutigen Argumentationsmustern auf, die individuelle Freiheiten und Eigentumsrechte gegen Kollektivgüter wie „Klimagerechtigkeit“ oder „Generationengerechtigkeit“ abwägen und systematisch abwerten.22
Verdummung durch Wissenschaftsbeugung
Das Motto dieses Berichts findet hier seine tiefere Bedeutung. Die „Verdummung“ manifestiert sich als „diskursive Dummheit“ 28 – die unreflektierte, aber moralisch hoch aufgeladene Wiederholung von Phrasen und Stereotypen, die eine differenzierte Analyse ersetzen. Juristische Begriffe werden nicht mehr präzise definiert, sondern zu politischen Kampfbegriffen umfunktioniert. Die Komplexität rechtlicher Abwägungen weicht der schlichten Logik des moralischen Imperativs.
Dieser Prozess lässt sich mit dem Qualitätsverlust bei künstlicher Intelligenz vergleichen, die nur noch mit ihren eigenen, bereits gefilterten Inhalten trainiert wird. Ein solches System gerät in eine Abwärtsspirale der Qualität, verliert den Bezug zur externen Realität und produziert am Ende nur noch verzerrte, in sich geschlossene und bedeutungslose Ergebnisse.29 Ähnlich ergeht es einem Rechtssystem, das sich zunehmend von seinen dogmatischen Grundlagen und der gesellschaftlichen Realität abkoppelt und nur noch im eigenen ideologischen Saft schmort. Es verliert an Präzision, Tiefe und letztlich an Legitimität.
Die Veränderung betrifft die Funktion der juristischen Sprache selbst. Sie dient nicht mehr primär der präzisen Beschreibung und logischen Ableitung, sondern der moralischen Signalisierung und politischen Mobilisierung. Ein Begriff wie „Eigentum“, dessen Inhalt sich aus Jahrhunderten dogmatischer Arbeit speist, wird plötzlich flüssig und muss sich gegen vage, aber emotional aufgeladene Kollektivgüter wie „Klimagerechtigkeit“ behaupten.18 Die entscheidende Frage in der juristischen Argumentation ist nicht mehr: „Ist diese Lösung systemgerecht und dogmatisch konsistent?“, sondern: „Dient diese Lösung der richtigen Gesinnung?“. Damit erfüllt sich Kirchmanns Prophezeiung auf neue Weise: Die Jurisprudenz wird zur „Orakelhalle“ 1, unvorhersehbar und willkürlich, weil ihre Leitprinzipien nicht mehr dem Recht selbst immanent sind, sondern von außen, aus der Sphäre der politischen Ideologie, diktiert werden. Dies ist der Kern der Verdummung: die Ersetzung komplexer, innerer Rechtslogik durch simple, äußere Gesinnungsbefehle.
Kapitel 3: Exponat A – Das Klima als juristischer Dietrich
Nichts illustriert die ökosozialistische Kaperung der Rechtswissenschaft so eindrücklich wie die Klimapolitik. Das Thema Klima fungiert als juristischer Dietrich, als Generalschlüssel, mit dem ganze Rechtsgebiete aufgebrochen, demokratische Prozesse umgangen und die Gewaltenteilung zugunsten einer aktivistischen Justiz verschoben werden. Im Zentrum dieses Manövers stehen das deutsche Klimaschutzgesetz und die strategischen „Klimaklagen“, die es zu einem Instrument der radikalen Transformation gemacht haben.
Das Gesetz, das Urteil und die Folgen
Der entscheidende Wendepunkt war der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 29. April 2021. Das Gericht erklärte das damalige Klimaschutzgesetz in Teilen für verfassungswidrig, weil es die Freiheitsrechte zukünftiger Generationen verletze, indem es ihnen einen zu großen Teil der Reduktionslast aufbürde.2 Als Reaktion darauf verschärfte die Bundesregierung das Gesetz drastisch: Das Ziel der Klimaneutralität wurde auf 2045 vorgezogen und die Zwischenziele für 2030 und 2040 massiv angehoben.22
Diese Entwicklung ist ein Paradebeispiel für judikativen Aktivismus. In der öffentlichen Anhörung des Bundestags zur Gesetzesnovelle äußerten Sachverständige aus Industrie und Gewerkschaften scharfe Kritik. Sie warnten, die Novelle gehe weit über die Forderungen des Verfassungsgerichts hinaus und es sei versäumt worden, die ökonomischen und sozialen Folgen der neuen Ziele abzuschätzen.22 Vertreter des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) und der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) kritisierten, dass der Entwurf Unsicherheit schaffe, da die konkreten Maßnahmen zur Zielerreichung völlig offenblieben und die Politik die Fragen nach Wirtschaftlichkeit und praktischer Umsetzbarkeit unbeantwortet lasse.22 Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) mahnte, die verschärften Ziele würden den Strukturwandel beschleunigen und Ängste um Arbeitsplätze schüren, weshalb Klimaschutz mit Beschäftigung und guter Arbeit verbunden werden müsse.22 Diese Bedenken wurden im politischen Prozess überrollt, angetrieben durch den Druck des Gerichtsurteils.
Die Klimaklage als strategische Waffe
Die eigentliche Triebfeder hinter diesem Prozess sind die sogenannten Klimaklagen. Sie werden von Umweltorganisationen wie dem BUND oder der Deutschen Umwelthilfe (DUH) systematisch als „Strategische Klagen“ eingesetzt, um die Regierung zum Handeln zu zwingen.2 Ihr Erfolg misst sich nicht allein am juristischen Sieg. Selbst gescheiterte Klagen gelten als Erfolg, wenn sie mediale Aufmerksamkeit erzeugen, den öffentlichen Druck erhöhen und so die gesellschaftliche Debatte in die gewünschte Richtung lenken.2 Diese Prozesse geben dem abstrakten Klimawandel ein menschliches, emotional ansprechendes Gesicht – vom peruanischen Bauern, der gegen RWE klagt, bis zu den Schweizer „Klimaseniorinnen“ –, was die Thematik für Gerichte greifbarer und juristisch handhabbarer macht.2
Der Mechanismus ist selbstreferenziell: Der Staat setzt sich unter Druck ambitionierte, aber vage Ziele. Aktivisten verklagen ihn dann auf Einhaltung dieser Ziele und Gerichte zwingen ihn zu konkreten, oft radikalen Maßnahmen. Als die Ampel-Koalition das Klimaschutzgesetz später „entkernte“, indem sie die starren Sektorziele aufweichte, folgte umgehend die nächste Verfassungsbeschwerde der DUH mit dem Argument, die Regierung weiche ihre eigenen Verpflichtungen auf und verschiebe die Lasten in die Zukunft.24 Die Justiz wird so zur obersten Vollstreckerin der Klima-Agenda, die das politische Ermessen der demokratisch legitimierten Regierung aushebelt.3
Damit vollzieht sich ein fundamentaler Wandel im deutschen Verfassungsrecht. Traditionell schützt das Grundgesetz konkrete, gegenwärtige Freiheitsrechte des Bürgers vor staatlichen Eingriffen (Abwehrrechte). Das Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts hingegen begründet eine positive Staatspflicht zum Schutz abstrakter Freiheiten zukünftiger Generationen. Das Gericht wandelt sich vom Hüter negativer Rechte zum Durchsetzer positiver Politikziele. Dies erfordert von den Richtern hochspekulative, im Grunde nicht justiziable Prognosen über zukünftige technologische, ökonomische und soziale Entwicklungen. Das Verfassungsgericht wird damit faktisch zur obersten Planungsbehörde der Nation – eine Rolle, für die es weder demokratische Legitimation noch fachliche Expertise besitzt. Der Klimaschutz wird zum juristischen Dietrich, der die Tore der Gewaltenteilung aufsprengt.
Kapitel 4: Exponat B – Das Lieferkettengesetz als bürokratisches Monstrum
Das zweite Exponat, das die ideologische Verirrung der deutschen Jurisprudenz belegt, ist das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG). Es gilt als Inbegriff eines Gesetzes, das, angetrieben von moralischem Eifer, ein „bürokratisches Monstrum“ 32 erschafft, immense Rechtsunsicherheit stiftet und dabei von fragwürdigem praktischem Nutzen ist. Es ist ein „moralisch aufgeladenes Projekt“ 33, das auf eklatante Weise deutsche Wertvorstellungen global durchzusetzen versucht 34 und dabei selbst an fundamentalen verfassungsrechtlichen Mängeln leidet.
Bürokratische Last und ökonomische Folgen
Das LkSG verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung weitreichender Sorgfaltspflichten in ihren Lieferketten, was massive Dokumentations-, Analyse- und Berichtspflichten nach sich zieht.33 Obwohl das Gesetz nominell nur große Unternehmen mit über 1.000 Mitarbeitern direkt adressiert, werden die Lasten in der Praxis über vertragliche Verpflichtungen und Abfragen an die unzähligen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) weitergereicht, die als Zulieferer fungieren.36 Dies führt zu einer enormen indirekten Belastung für das Rückgrat der deutschen Wirtschaft.36 Unternehmen müssen erhebliche personelle Ressourcen für die Compliance aufwenden, was bei einem Drittel der betroffenen Firmen fünf oder mehr neue Stellen bedeutet.38 Die Folge ist ein gewaltiger bürokratischer Mehraufwand für einen nur schwer bezifferbaren Nutzen.36
Konzeptionelle und verfassungsrechtliche Abgründe
Die juristische Kritik am LkSG ist fundamental und vernichtend. Sie zielt auf das Herzstück des Gesetzes und stellt seine Verfassungsmäßigkeit in Gänze infrage.
- Verstoß gegen das Bestimmtheitsgebot: Das Gesetz ist durchzogen von einer „Vielzahl unbestimmter Rechtsbegriffe“.33 Begriffe wie „angemessen“ oder „substantiierte Kenntnis“ sind so vage, dass Unternehmen kaum verlässlich wissen können, was von ihnen verlangt wird. Dies eröffnet der zuständigen Behörde, dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), einen weiten Ermessensspielraum bei der Verhängung empfindlicher Bußgelder und schafft erhebliche Rechtsunsicherheit. Juristen sehen darin einen klaren Verstoß gegen das verfassungsrechtliche Bestimmtheitsgebot (
Art. 103 Abs. 2 GG für Straf- und Bußgeldtatbestände).40 - Verletzung von Grundrechten: Die detaillierten Vorgaben zur Einrichtung von Risikomanagementsystemen, Beschwerdeverfahren und Präventionsmaßnahmen stellen nach Ansicht von Rechtswissenschaftlern einen tiefgreifenden Eingriff in die unternehmerische Freiheit dar. Dies könnte die durch Art. 12 GG (Berufsfreiheit) und Art. 14 GG (Eigentumsgarantie, Schutz des eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebs) geschützte unternehmerische Entscheidungsfreiheit verletzen.40
- Abwälzung staatlicher Aufgaben: Ein zentraler konzeptioneller Kritikpunkt ist, dass der Staat seine ureigenen Aufgaben – die Gewährleistung von Menschenrechten im Ausland durch Außen- und Entwicklungspolitik – auf private Unternehmen abwälzt.34 Anstatt selbst für die Einhaltung internationaler Standards zu sorgen, bürdet er diese Verantwortung der Wirtschaft auf.
- Imperialismus der Werte: Das Gesetz wird scharf dafür kritisiert, in „geradezu imperialistischer Weise deutsche Wertvorstellungen ins Ausland“ zu exportieren.34 Die Ironie dieser Situation ist kaum zu überbieten: Ein Gesetz, das moralische Standards weltweit durchsetzen soll, ist nach den Maßstäben seines eigenen Herkunftslandes möglicherweise selbst verfassungswidrig. Es droht, sich als kostspieliger „Papiertiger“ 41 zu erweisen, der für deutsche Unternehmen enorme Kosten und Rechtsrisiken schafft, ohne die Lage der Menschen in den Lieferketten nachweislich zu verbessern.
Das LkSG ist damit ein Paradebeispiel für eine neue Art von „performativer Gesetzgebung“. Ihr primäres Ziel scheint nicht die effektive und praktische Problemlösung zu sein, sondern die symbolische Demonstration moralischer Tugendhaftigkeit auf der Weltbühne. Die Struktur des Gesetzes als „Bemühenspflicht“ und nicht als „Erfolgspflicht“ 33 unterstreicht dies: Ein Unternehmen kann vollkommen gesetzeskonform handeln, ohne auch nur eine einzige Menschenrechtsverletzung verhindert zu haben, solange es seine Bemühungen nur lückenlos dokumentiert. Der reale, greifbare Effekt ist die Schaffung einer riesigen Compliance-Industrie und bürokratischer Lasten in Deutschland. Die Politik kann einen moralischen Sieg für sich verbuchen, während die Kosten von der Privatwirtschaft getragen werden. Das Gesetz wird zum politischen Theaterstück, und das Rechtssystem ist gezwungen, die Rolle des Bühnenmanagers zu übernehmen.
Schlussfolgerung: Die Jurisprudenz im Würfelbecher
Die Analyse der vergangenen Kapitel zeichnet das Bild einer Rechtswissenschaft im Zustand des fortschreitenden Verfalls. Eine ideologisch aufgeladene Agenda-Maschinerie hat die Disziplin erfasst, ihre wissenschaftliche Methodik korrumpiert und sie zu einem Werkzeug der gesellschaftlichen Transformation umfunktioniert. Die Fallbeispiele des Klimaschutzgesetzes und des Lieferkettengesetzes sind keine Ausreißer, sondern symptomatische Exponate einer tiefgreifenden Pathologie. Sie zeigen, wie eine von Gesinnung getriebene Jurisprudenz Gesetze hervorbringt, die nicht nur ökonomisch destruktiv und bürokratisch erstickend sind, sondern auch an fundamentalen rechtsstaatlichen und verfassungsrechtlichen Mängeln leiden.
Wir kehren am Ende zu Julius von Kirchmann zurück. Er sah die Jurisprudenz seiner Zeit als eine Wissenschaft, die sich in einer „zirkulären Elfenbeinturmdiskussion“ verliere und deren Ergebnisse im Einzelfall so ungewiss seien wie der Ausgang eines Wurfes aus dem „Würfelbecher“ oder die Weissagung aus einer „Orakelhalle“.1 Er warf ihr vor, zur „Dienerin des Zufalls“ geworden zu sein, weil ihr Gegenstand – das positive Gesetz – selbst zufällig und veränderlich war.1
Heute ist die Lage ungleich schlimmer. Der „Zufall“, dem die Rechtswissenschaft heute dient, ist nicht mehr die Willkür eines Gesetzgebers, der im Rahmen demokratischer Prozesse agiert. Der neue Herr ist die Willkür einer politischen Ideologie, die sich außerhalb dieser Prozesse etabliert hat und die Wissenschaft zu ihrer Erfüllungsgehilfin macht. Die Rechtsunsicherheit entspringt nicht mehr der Veränderlichkeit des Gesetzes, sondern der Unberechenbarkeit der Gesinnung. Wenn die Auslegung des Rechts nicht mehr von dogmatischer Kohärenz, sondern von der Übereinstimmung mit einem flüchtigen politischen Zeitgeist abhängt, dann ist der Würfelbecher zur perfekten Metapher für den Zustand der Jurisprudenz geworden.
Die „Verdummung durch Wissenschaftsbeugung“ hat die Rechtswissenschaft an den Rand ihrer eigenen Auflösung geführt. Eine Disziplin, die ihre wissenschaftlichen Grundlagen – Neutralität, Systematik, Widerspruchsfreiheit – aufgibt, um einer politischen Mission zu dienen, verliert nicht nur ihre intellektuelle Integrität, sondern auch ihre gesellschaftliche Funktion. Ein Rechtssystem, das zum Werkzeug des sozialen Umbaus wird, versagt bei seiner elementarsten Aufgabe: der Gewährleistung von Gerechtigkeit, Freiheit und Rechtssicherheit. Es ist höchste Zeit für eine Rückbesinnung, für die Wiederherstellung der klaren Trennung von Recht und Politik und für ein Ende der Unterwerfung der Wissenschaft unter die Ideologie. Andernfalls werden nicht nur Bibliotheken zu Makulatur, sondern der Rechtsstaat selbst.
Referenzen
Prüfung der Quellen erfolgte am 7. August 2025, markiert mit “.chkd.” – Transparenzhinweis: Selbstverständlich wurden KI-Tools bei der Erstellung dieses Aufsatzes verwendet.
- Die Werthlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft – Wikipedia, .chkd., https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Werthlosigkeit_der_Jurisprudenz_als_Wissenschaft
- Klimaklagen: Wenn Bürger für Klimaschutz vor das Gericht ziehen – Deutschlandfunk, .chkd., https://www.deutschlandfunk.de/klimaklagen-deutschland-klimaziele-erfolg-scheitern-100.html
- Politisierung: Definition & Justiz | StudySmarter, .chkd., https://www.studysmarter.de/studium/rechtswissenschaften/internationale-beziehungen/politisierung/
- Der „Anschein der Neutralität“ als schützenswertes Verfassungsgut? – Verfassungsblog, .chkd., https://verfassungsblog.de/der-anschein-der-neutralitaet-als-schuetzenswertes-verfassungsgut/
- 456 Josef Franz Lindner RphZ Brauchen wir eine Theorie der Rechtsdogmatik? Besprechung von – Nomos eLibrary, .chkd., https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/2364-1355-2019-4-456.pdf
- Agenda-Setting-Theorie: Einfluss & Medien | StudySmarter, .chkd., https://www.studysmarter.de/studium/germanistik/medienwissenschaft/agenda-setting-theorie/
- Agenda-Setting: Politik & Theorie – StudySmarter, .chkd., https://www.studysmarter.de/schule/politik/politikanalyse/agenda-setting/
- Agenda Setting • Definition | Gabler Wirtschaftslexikon, .chkd., https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/agenda-setting-28237
- Agenda-setting theory – Wikipedia, .chkd., https://en.wikipedia.org/wiki/Agenda-setting_theory
- Agenda Setting in der PR einfach erklärt – Aufgesang, .chkd., https://www.sem-deutschland.de/online-marketing-glossar/agenda-setting/
- Agenda Setting – Definition & Bedeutung – JuraForum.de, .chkd., https://www.juraforum.de/lexikon/agenda-setting
- Katharina van Elten, Tanja Klenk, Britta Rehder – Einleitung: Interessengruppen und Recht, Interessengruppen im Recht, .chkd., https://d-nb.info/1294111949/34
- Plenarprotokoll 19/62 – Abgeordnetenhaus Berlin, .chkd., https://www.parlament-berlin.de/ados/19/IIIPlen/protokoll/plen19-062-pp.pdf
- Online-Rezensionen des Jahrbuchs zur Liberalismus-Forschung 2/2017 – recensio.net, .chkd., https://www.recensio.net/rezensionen/zeitschriften/jahrbuch-zur-liberalismus-forschung/2017/2/issue.pdf/@@download/file/recensio%20Sammelmappe%20JzLF%202-17.pdf
- Ökosozialismus – Wikipedia, .chkd., https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kosozialismus
- Mario Keßler, Ossip K. Flechtheim. Politischer Wissenschaftler und Zukunftsdenker (1909-1998), Böhlau Köln, 2007 (Zeithistori, .chkd., https://zeitgeschichte-digital.de/doks/frontdoor/deliver/index/docId/841/file/ke%C3%9Fler_flechtheim_zukunftsdenker_2007_de.pdf
- Panel ÖKO-SOZIALISMUS oder Barbarei – warum GRÜN=ROT Rosa Luxemburg würde heute wahrscheinlich eine damalige Losung leicht, .chkd., https://s2a2aa3fea164edb9.jimcontent.com/download/version/1660979904/module/14574012733/name/hl%20zz%20ev%20Panel%20RL%20Konferenz.pdf
- Themenfelder – Rosa-Luxemburg-Stiftung, .chkd., https://www.rosalux.de/stiftung/zid/themenfelder
- Der erschöpfte Planet – Rosa-Luxemburg-Stiftung, .chkd., https://www.rosalux.de/fileadmin/ls_ni/dokumente/publikationen/RLNds_Der_ersch%C3%B6pfte_Planet.pdf
- Überlegungen zum Workshop «Ökosozialistische Strategien» am Anderen Davos 2025, .chkd., https://sozialismus.ch/oekologie/2025/ueberlegungen-zum-workshop-oekosozialistische-strategien-am-anderen-davos-2025/
- Klimagerechtigkeit und sozialökologische Transformation in der Sozialen Arbeit, .chkd., https://www.dgsa.de/fachgruppen/klimagerechtigkeit-und-sozial-oekologische-transformation-in-der-sozialen-arbeit/
- Bundestag verschärft das Klimaschutzgesetz – Deutscher Bundestag, .chkd., https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw25-de-klimaschutzgesetz-846922
- Klimaklage – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), .chkd., https://www.bund.net/handeln-sie-nicht-handeln-wir/
- Klimaklagen gegen die Bundesregierung – Deutsche Umwelthilfe e.V., .chkd., https://www.duh.de/informieren/klimaschutz/klimaklagen-gegen-die-bundesregierung/
- Rechtsdogmatik – Wikipedia, .chkd., https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsdogmatik
- www.ssoar.info Rechtsdogmatik und Rechtspolitik unter dem Einfluß des Richterrechts, .chkd., https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/32172/ssoar-2003-ruthers-Rechtsdogmatik_und_Rechtspolitik_unter_dem.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Ideologie der Gemeinschaft und die Abschaffung des subjektiven Rechts − Recht und Rechtswissenschaft im Nationalsozialismus – Rechtswissenschaftliche Fakultät – Universität Münster, .chkd., https://www.jura.uni-muenster.de/de/institute/lehrstuhl-fuer-buergerliches-recht-rechtsphilosophie-und-medizinrecht/studieren/recht-und-rechtswissenschaft-im-nationalsozialismus/
- Strategien der Verdummung, .chkd., https://www.uni-giessen.de/de/fbz/fb05/germanistik/abliteratur/ndlk/projekte/komik/komikaufsaetze/diskursive-dummheit.pdf
- Mit KI droht eine menschliche Verdummung statt Steigerung der Intelligenz – FOCUS online, .chkd., https://www.focus.de/wissen/studie-der-university-of-oxford-mit-ki-droht-eine-menschliche-verdummung-statt-steigerung-der-intelligenz_id_260737355.html
- #55: Klimaklage erfolgreich gescheitert, 9 Länder wollen EMRK neu diskutieren, VW-Manager verurteilt, 5 Jahre Zeit für Fachanwalts-Fälle, .chkd., https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/55-klimaklage-gescheitert–neun-laender-kritik-egmr-vw-manager-verurteilt-5-jahre-fachanwalts-faelle
- Klimaklagen: Richter entscheiden nach veralteten Regeln – das muss sich endlich ändern – Kommentar – DER SPIEGEL, .chkd., https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/klimaklagen-richter-entscheiden-nach-veralteten-regeln-das-muss-sich-endlich-aendern-kommentar-a-d3ae0807-1251-47a8-8885-ed34dde8a9fe
- Bürokratie – DER SPIEGEL, .chkd., https://www.spiegel.de/thema/buerokratie/
- Lieferkettenverantwortung: Wettbewerbsökonomische Kritik und Alternativen, .chkd., https://law-journal.de/lieferkettenverantwortung-wettbewerbsokonomische-kritik-und-alternativen/
- Praxisleitfaden Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – Nomos eLibrary, .chkd., https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783800594726.pdf?download_full_pdf=1&page=1
- Überblick über das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) – Taylor Wessing, .chkd., https://www.taylorwessing.com/de/insights-and-events/insights/2021/07/overview-of-the-german-supply-chain-due-diligence-act
- Lieferkettengesetz (LkSG) birgt Risiken für das Handwerk | ZDH, .chkd., https://www.zdh.de/themen-und-positionen/lieferkettengesetz/
- Zusammenarbeit in der Lieferkette zwischen verpflichteten Unternehmen und ihren Zulieferern – BAFA, .chkd., https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Lieferketten/faq_zusammenarbeit_in_der_lieferkette.pdf?__blob=publicationFile&v=6
- Ernüchternde Zweitbilanz zum Lieferkettengesetz – IHK Düsseldorf, .chkd., https://www.ihk.de/duesseldorf/presse/pressearchiv/ernuechternde-zweitbilanz-zum-lieferkettengesetz-6239976
- Behördliche Kontrolle und Durchsetzung der Pflichten des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes – Nomos eLibrary, .chkd., https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783748929703-97.pdf
- Mehr Fragen als Antworten: Kritische Anmerkungen zum … – LRZ.legal, .chkd., https://lrz.legal/de/lrz/mehr-fragen-als-antworten-kritische-anmerkungen-zum-inkrafttreten-des-lieferkettensorgfaltspflichtengesetz-lksg
- Zwei Jahre Lieferkettengesetz Ein Erfahrungsbericht – Misereor, .chkd., https://www.misereor.de/fileadmin/user_upload/Infothek/zwei-jahre-lieferkettengesetz-ein-erfahrungsbericht.pdf